Reformstaatsvertrag: Wie die Länder jetzt den Presse-Machenschaften des ÖRR ein Ende bereiten könnten
Bis Freitagabend beraten die Ministerpräsidenten über einen Reformstaatsvertrag, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschränken soll. ARD, ZDF und Co. sind nicht nur kostspielig, sondern greifen mit ihren Angeboten unerlaubterweise in den freien Pressemarkt ein. Das soll sich jetzt ändern.

Bald könnten die Forderungen nach einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die Tat umgesetzt werden. Die Bundesländer haben Ende September einen 112-seitigen Entwurf für einen Reformstaatsvertrag präsentiert, der einschneidende Veränderungen vorsieht, vor allem die Verschlankung der Sender und eine transparentere Finanzierung. Die Maßnahmen könnten die Rundfunkgebühren sinken lassen und den Aufgabenbereich von ARD, ZDF und Co. durch konkrete Zuschreibungen genau festlegen.
Spätestens mit dem Aufstieg der AfD in Sachsen und Thüringen ist klar: Ein großer Teil der Gesellschaft befürwortet eine Reform des Medienstaatsvertrags. Nachdem der konkrete Entwurf veröffentlicht wurde, zeigten sich ARD und ZDF schockiert und als Opfer einer solchen Novellierung. „Was ist hier los?“, fragten Instagram-Konten von Tagesschau und ZDFheute in Beiträgen, die mit einem schwarzen Zensurblock verdeckt waren (Apollo News berichtete).
Werbung
Die Sender beziehen sich damit auf einen Neuerungsvorschlag der Länder. Im Fokus steht der dritte Abschnitt des Medienstaatsvertrags, der die Zuständigkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks regeln soll. Unter Paragraph 30 finden sich die genauen Regulierungen für Telemedien, die Online-Angebote der Rundfunkanstalten. „Die eigenen Portale sowie Telemedien auf Drittplattformen dürfen jeweils nicht presseähnlich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton zu gestalten“, soll es dort jetzt heißen. Lediglich „sendungsbegleitende Texte“, Überschriften, Foren oder Ähnliches sind zulässig.
Auf Instagram haben die Tagesschau sowie ZDFheute bereits auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Konkret würde der Reformstaatsvertrag vorsehen, dass die Internetangebote „weniger Text und mehr Video“ anbieten müssten und erst über ein Thema berichten dürften, wenn dieses von den Rundfunkangeboten, also Fernsehen oder Radio, behandelt wurde, klagen die Sender.
Werbung

In den im Vertragsentwurf festgehaltenen Anmerkungen heißt es dazu: „Der Bezug muss zu einer eigenen Sendung hergestellt werden, wobei ‚eigen‘ nicht zwangsläufig selbst produziert bedeutet, aber im eigenen Angebot genutzt.“ Brisant: Die entscheidende Formulierung findet sich fast wortgleich im aktuell gültigen Vertrag. „Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vordergrund stehen darf“, heißt es da.
Lesen Sie auch:
Büren
Weiße Frau begrapscht schwarzen Jungen: Bizarres Plakat im Freibad nach Kritik abgehängt
Das Freibad in Büren hat das Plakat, auf dem eine weiße Frau einen schwarzen Jungen mit Beinprothese begrapscht, wieder abgehängt. Zuvor hatte sich der Bürgermeister der Stadt dafür entschuldigt.Neues Format
Zehn Jahre nach „Wir schaffen das“: WDR inszeniert Gespräch mit Merkel und Migranten
„Wir reden immer viel über Menschen, die zu uns kamen, aber nicht mit den Menschen, die zu uns kamen“: Zehn Jahre nach Beginn der Migrationskrise zeigt der WDR die Ex-Kanzerlin Angela Merkel in einem neuen Gesprächsformat – zusammen mit ausgewählten Migranten.Die Befürchtung der öffentlich-rechtlichen Medien, sie könnten in Zukunft keine Textbeiträge auf Plattformen wie Instagram verbreiten dürfen, ist eigentlich obsolet – denn diese Regelung ist längst gültig. Mit anderen Worten: Tagesschau und Co. verstoßen momentan bereits gegen den Medienstaatsvertrag. Schon heute heißt es, Telemedienangebote sollen „nach Möglichkeit eine Einbindung von Bewegtbild oder Ton“ verfolgen – der Großteil der Instagram-Beiträge von Tagesschau und ZDFheute sind Bildbeiträge mit Text.
Auch mit Blick auf das öffentlich-rechtliche Netzwerk Funk, das die Online-Angebote von ARD und ZDF betreut, könnten die Rundfunkanstalten eingeschränkt werden. Die Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in zwei bis drei Angebote zusammengeführt werden. Im Umkehrschluss könnte das bedeuten, dass sämtliche Funk-Kanäle in einem übergreifenden Angebot verbunden werden müssen.
Werbung
Funk umfasst derzeit 60 bis 70 Formate auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. In den Anmerkungen zu den Änderungen der Telemedien-Regeln halten die Länder klar fest, dass „es einer aus dem Auftrag abgeleiteten Begründung für jedes einzelne (also ‚eigenständige‘) eigene Portal geben muss“. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Länder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu den Funktionen, die sich aus seinem Namen ableiten lassen, zurückführen möchten.
An verschiedenen Stellen wird darauf hingewiesen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien die Lebensrealität der Menschen auf regionaler und vor allem bundesweiter Ebene wahrhaftig wiedergeben sollen. Ein Verbot von Exklusiv-Recherchen ergibt sich daraus nicht, jedoch ist der Auftrag klar: Der freie Markt soll mitspielen können. Meldungen sollen die Berichterstattung dominieren. Vor allem in Textform greifen die beitragsfinanzierten Medien, beispielsweise die Webseite der Tagesschau, allerdings immer wieder mit exklusiven Recherchen in den freien Markt ein.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht mehr als er soll
Der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), der Interessenverband der deutschen Tages-, Sonntags- und politischen Wochenpresse, moniert schon seit Jahren, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ihre Online-Angebote mit Texten und Beiträgen immer weiter erweitern.
Werbung
Weil die Finanzierung gesichert ist, sind öffentlich-rechtliche Medien nicht auf den Erfolg der eigenen Recherche angewiesen und beeinträchtigen somit die freien Medien, die aus einschlägigen Recherchen Einnahmen schöpfen. Aus diesem Grund sieht der Reformstaatsvertrag vermutlich die Rückkehr zu mehr audiovisuellen Inhalten vor, wodurch drastische Eingriffe in den freien Markt verhindert werden können, da journalistische Publikationen nach wie vor in Textform dominieren.
Um das zu erreichen, möchten die Länder auch die „Reduktion der Anzahl digitaler Spartenkanäle“, den „Abbau von Mehrfachstrukturen“ sowie die „Nutzung der Möglichkeiten der Flexibilisierung“ festlegen, wie den Anmerkungen zu Paragraph 28 zu entnehmen ist.
Die Verschlankung des gesamten Komplexes beginnt bei den Spartenkanälen tagesschau24, Phoenix, ARD-alpha und ZDFinfo, die in maximal zwei Angebote zusammengefasst werden sollen. Neben der Reduktion von Zweit- oder Drittkanälen sollen auch die Rundfunkanstalten konsolidiert werden: In Paragraph 30e wird eine engere Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender untereinander dargelegt.
Werbung

Als Ausnahme gilt unter anderem, wenn „eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben hat, dass keine langfristige Kosteneffizienz zu erwarten ist“. Solange eine Zusammenarbeit kostengünstiger ist, müssen ARD, ZDF und Deutschlandradio also kooperieren – was sich für den Nutzer positiv auf die Rundfunkgebühren auswirken könnte.
Für die Berechnung der Beiträge soll nach wie vor die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zuständig sein, die alle zwei Jahre einen Bericht zur Finanzlage der Rundfunkanstalten vorlegen muss. Die Finanzierung ist der umstrittenste Punkt der Reform. Die KEF hat die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf 18,94 Euro im Monat ab Januar empfohlen – einige Länder haben sich bereits skeptisch geäußert (Apollo News berichtete).
Wie die KEF soll auch ein neuer unabhängiger übergeordneter sechsköpfiger Medienrat einen Bericht bezüglich der Auftragserfüllung alle zwei Jahre ausarbeiten, wie in Paragraph 26b des Entwurfs zu lesen ist. Die in den einzelnen Landesrundfunkanstalten organisierten Rundfunkräte, die die inhaltliche Überprüfung vornehmen, bleiben überdies bestehen.
Zudem soll das Angebot der Sender mit Leistungsanalysen überprüft werden, sodass beispielsweise die „Ausgewogenheit sowie Themen- und Meinungsvielfalt“ stetig gegeben sind. Aktuell wird in Paragraph 26 lediglich festgehalten: Der „Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen.“
Werbung
Dieser Auftrag wird in dem Entwurf ergänzt: ARD, ZDF und Deutschlandradio sollen „interaktive Kommunikation mit den Nutzern“ anbieten „sowie verstetigte Möglichkeiten der Partizipation“. Eine derartige klare Aussage über die Teilhabe der Nutzer am Angebot fehlte zuvor. Später wird festgehalten, ein „Gesellschaftsdialog“ sollte angestrebt werden, sodass auch die Bedürfnisse derjenigen berücksichtigt werden, die das Angebot nicht nutzen. Damit könnten Ablehnungstendenzen, sowohl auf Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als auch seitens dessen Gegner, bestmöglich verhindert werden.
Der Entwurf sieht ganz klar vor, den Nutzer und dessen Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Das zeigt sich auch in Paragraph 35, der die Kostensteuerung bestimmt. „Bei Aufstellung und Ausführung ihres Haushaltsplans haben die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten“, heißt es da. Ein klarer Auftrag an die Sender zu sparen.
Massiver Senderabbau geplant
Das wird auch durch eine Novellierung des Hörfunkangebots der Landesrundfunkanstalten deutlich. Künftig soll es pro Anstalt nur vier derartige Angebote, also vier Radiosender oder auch Podcasts, geben, plus ein zusätzliches für jeweils sechs Millionen Einwohner im Sendegebiet. Grundsätzlich gilt zudem: Eine Anstalt darf mindestens so viele Hörfunkangebote etablieren, wie sie Länder betreut. Momentan dürften damit 53 Programme geführt werden: Acht vom NDR, sieben jeweils vom MDR und WDR, jeweils sechs vom SWR, RBB sowie BR. Außerdem fünf vom HR und jeweils vier von RB und SR. Über 20 Radiosender könnten wegfallen.
Eine Forderung, die in den letzten Jahren aufgrund des wachsenden Angebots der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer häufiger geäußert wurde. Auch Vorschläge für gemeinsame technische Lösungen der einzelnen Sender wurden immer wieder verbreitet. Die unterschiedlichen Portale, beispielsweise Mediatheken, sollen laut dem Länder-Entwurf zentraler organisiert werden. Denkbar wären gemeinsame Zugänge zu den Radiosendern über eine Audiothek oder eine gemeinsame Mediathek beziehungsweise Übertragungsseite der unterschiedlichen Kanäle.
Als Beispiel: Übertragungen der Fußball-Nationalmannschaftsspiele oder Wiederholungen der Olympischen Spiele sind im Internet entweder auf der Seite der ARD oder des ZDF zu finden. Künftig könnten beide Programme in einem Portal angeboten werden. Dieser Vorstoß wird in Paragraph 30f konkret festgehalten: „Ziel des gemeinsamen technischen Plattformsystems ist der Aufbau einer gemeinsam genutzten Infrastruktur.“
Bis Freitagabend soll die Novellierung des Medienstaatsvertrags auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig thematisiert werden. Anschließend könnte der Entwurf bei einer bislang nicht vorhersehbaren Einigung den Länderparlamenten zur Vorunterrichtung vorgelegt, von den Ministerpräsidenten unterzeichnet und anschließend von den Landtagen wiederum ratifiziert werden. Bereits im Sommer 2025 könnte der Reformstaatsvertrag dann in Kraft treten.
Während interne Strukturen größtenteils aufrechterhalten werden, sollen offenbar vor allem übergreifende Verbindungen stark verändert und eingeschränkt werden. Letztlich könnte der Reformstaatsvertrag eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bezwecken – weniger Mitarbeiter, weniger Formate, geringere Rundfunkgebühren.
Damit würden vor allem SPD und CDU, die derzeit jeweils sieben Ministerpräsidenten stellen, der AfD zuvorkommen. Diese hatte angekündigt, nach den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg den Medienstaatsvertrag zu kündigen, wenn die Partei in Regierungsposition kommt. Danach sieht es jedoch momentan nicht aus.
Einerseits werden die Befugnisse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Änderungen derartig eingeschränkt, dass sich viele Wähler zufrieden zeigen dürften. Andererseits werden die Strukturen und Arbeitsplätze erhalten, die durch eine Kündigung des Vertrags entfallen wären. Betroffen wären nicht nur Redakteure, sondern eben auch Techniker oder die Musiker der Rundfunkorchester – beispielsweise des MDR in Leipzig. Man schlägt jetzt einen Mittelweg ein.
Anmerkung: Auf der Ministerpräsidentenkonferenz vom 23. bis 25. Oktober wurde eine Beschlussfassung des Reformstaatsvertrags vereinbart und veröffentlicht. Daraus ergeben sich leichte Änderungen. So soll 3sat nicht länger in den Kultursender Arte integriert werden.
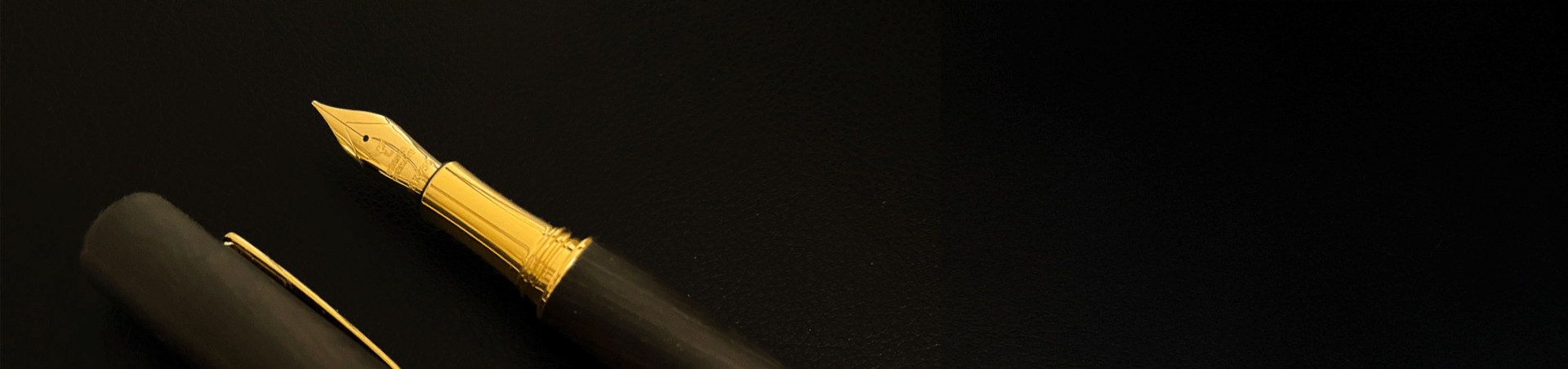




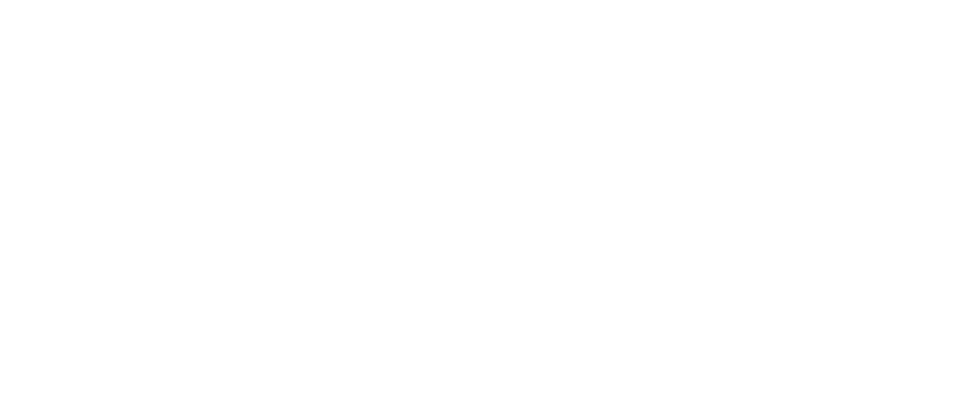
Es wird sich nichts ändern. Der ÖRR ist linksgrün dominiert. Und die ReGIERung wird sich ihr Propagandasprachrohr ja nicht nehmen lassen. Diesen Filz könnte man nur entwirren, wenn der Rundfunkstaatsvertrag gekündigt wird. Der ÖRR muß grundlegend neu aufgestellt werden – kleiner, ohne Zwangsabgaben und politisch wirklich neutral.
Das ist nur Verarschung! Die ändern gar nichts!
Zwangsgebühren abschaffen, dann können sie von mir aus mit ihren Verdummungssendungen fortfahren und sich gegenseitig die Preise verleihen.
Das dürfte ein harter Kampf werden, der öör versteht sich als ausführendes Staats-Organ der links-grünen Politik. Sehr spannend aufbereitet im Interview mit Ulrich Vosgerau auf JF. Aber auch hier dürfte der gemeinsame und nachhaltige Geldentzug den Laden ganz schnell zum Stillstand bringen.
Am Ende werden die Zwangsbeiträge wieder Erhöht ,und die Politiker haben einen schönen Nebenjob sicher .Die eine Krähe hakt doch der anderen kein Auge aus ..oder ..??
Die Lösung ist so einfach. Streicht die Zwangsfinanzierung dieser Propagandasender und der Rest erledigt sich von allein!
Moin,wie sagte einst ein Politiker ,, “ Selbst dann,wenn man eine rosarote Brille aufsetzt,werden Eisbären nicht zu Himbeeren.
Es wird sich nichts ändern….
Solange es in den Ländern mit erzwungenen Koalitionen Regierungen gibt ,ist das Land geknebelt.
Jeder vertritt seine Ideologien.
Es wurde noch nichts entschieden, aber bei X gehen die Meinungen schon wieder dahin das Änderungen nur Rechten dient.
Wenn nicht zum Schluss wieder nur heiße Luft dabei rauskommt. Man ist es gewohnt.
Ein Volksentscheid über die Zukunft des ÖR, wie in der Schweiz oder Dänemark, wäre nun angebracht und die demokratischste Entscheidung.
In Dänemark wurde der Rundfunkbeitrag abgeschafft.
Mehr Demokratie wagen, forderte einst ein Kanzler der Sozialdemokraten. Dann lasst uns damit beim Regierungs- TV anfangen. Oder fürchten die Sozen die Stimme des Volkes?
ÖRR verstößt aktuell bereits seit vielen Jahren massiv gegen geltendes Recht. Wieso sollten ausgerechnet dessen Nutznießer – die Corona-Parteien – das eindämmen?!
Es hilft nur eines: ÖRR muss weg. So schnell wie möglich.
Der Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg stellte erst jüngst fest, dass zumindest beim SWR der weit überwiegende Anteil der Beitragsgelder dafür verwendet wird, die dortigen Mitarbeiter später im Alter materiell besser zu stellen. Der gesetzliche Auftrag ist daher längst zur bloßen Nebensache geworden. Dennoch leistet sich Deutschland den weltweit teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Letztlich finanzieren die Bürger dadurch etwas, das völlig außerhalb des Medienstaatsvertrags liegt. Dessen Novellierung macht schon allein deswegen keinen Sinn. Der in Rede stehende Missstand, dass in Wirklichkeit die Sendeanstalten inzwischen nichts weiter als Versorgungswerke sind, kann damit nicht behoben werden.
Abschaffen ich schau kein ÖRR mehr! Diese Links Grüne Propaganda brauche ich nicht!
Mir fehlt als erstem Schritt die Anpassung der extrem hohen Vergütungen und der Altersversorgung.
Wie nennt man Organismen die sich bis zum Tode von ihrem Wirt ernähren?
Es braucht keine Reformation. Der ÖRR kann ruhig weiterhin die Meinung der Regierung propagieren. ABER NICHT AUF MEINE KOSTEN!
Apollo News ist der neue Goldstandard in den Nachrichten. Knallhart recherchiert und ohne Belehrung, und die hübsche Larissa Fußer macht es perfekt
Hab bei Insta diese Zensurkacheln gesehen und musste lachen. Das hatte was von Memory. Die merken ja nicht mehr, wie peinlich sie sind.
Von mir aus kann man alles bis auf Arte und ZDFneo einstampfen, dann braucht man auch nicht 12 Intendanten sondern noch einen und der/die bekommt auch auch nicht 300.000€ sondern noch 60.000€.
Die „Reform“ ist ein homöopathisches Reförmchen! Ich will VOD (Video On Demand) – nur VOD! Der ÖRR kriegt dann direkt finanzielle Rückmeldung, was beim Zuschauer ankommt und was besser ganz schnell eingestampft wird!
Solange Politiker in den Gremien sitzen, wird sich kaum was ändern. Schickt ARD und ZDF in die freie Marktwirtschaft und es ist Schluss mit den Zwangsgebühren. Das ZDF mit dem größten europäischen Medienhaus, ARD mit einer wahnwitzig riesigen Struktur, wozu sogar Hotels und Tankstellen gehören, sowas braucht kein ÖRR. Ein Propagandasender der Regierung, Phönix, reicht vollkommen.
Dieser politisch gewollte und geförderte Meinungssumpf kann nur durch eine tiefgehende Zwangsdrainage in Form einer umfassenden monetären Trockenlegung, gesichert nachhaltigen Abraumentsorgung und investigativen Resilenzförderung, zu einer mentalen Neubesiedlung freigegeben werden.
Eine Mammutaufgabe …
Solange POLITIKER den ÖRR kontrollieren und ihre Propaganda verbreiten, steht dem ÖRR nicht 1 Cent zu.
Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix. Es sind immer noch die selben Figuren im Spiel, die aus einer zur Neutralität verpflichteten Anstalt, ein vertragswidriges Propagandamedium gemacht haben. Verträge sind dazu da, konsequentzlos gebrochen zu werden.
Die Medien fallen zum Schluss in einer Diktatur
Seit ich vor 28 Jahren bei Pro 7 in der Buchhaltung gearbeitet habe, schaue ich kein Fernsehen und Werbung und Nachrichten habe ich seit 43 Jahren nie gesehen. In der Pubertät war mir klar, dass wir verarscht werden und daher habe ich lieber Bücher gelesen und da waren einige gute wie 1984, Psychologie der Massen, Admiral byrd, etc dabei
Ich habe kein Mitleid mit diesen Propagandersendern.Von mir aus können und müssen die soviel Leute rausschmeißen wie es nur geht.
All die Angestellten beim ÖRR haben kein Gewissen,das haben sie deutlich bei Corona gezeigt.
Ich könnte bei solchen Sendern nicht arbeiten,wenn ich weiss,das was da ausgestrahlt wird ,absoluter Quatsch und unwahr ist.
Wer ein Gewissen hat und jeden Morgen in den Spiegel schaut sollte auspacken,was da so alles abläuft bei ÖRR.
Und ich bin fest davon überzeugt das da noch mehr „Leichen im Keller“ liegen.Und die sollte man ausgraben.