Schatten-Netzwerk: Das gefährliche Spiel des Verfassungsschutzes mit Fake-Accounts auf Social-Media
Zunehmend wird die Größe des Netzwerks des Verfassungsschutzes im Internet bekannt. Es ist gut möglich, dass die Anzahl der durch den Inlandsgeheimdienst genutzten Fake-Accounts weit in die Tausenden reicht. Doch das birgt Gefahren.

Bislang wurden in der Geschichte der Bundesrepublik nur zwei politische Parteien durch das Bundesverfassungsgericht verboten. Die Hürden für ein solches Verbot sind hoch. Dass es bisher nicht zu einem solchen dritten Parteiverbot gekommen ist, trägt auch der Verfassungsschutz eine erhebliche Mitverantwortung. Im Jahr 2003 entschieden die Richter in Karlsruhe gegen ein Verbot der NPD. Die Führungsebene der Partei war zu stark mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt, die die Partei unter Umständen mitgelenkt haben.
Nach dem Karlsruher Urteil erlebte die totgeglaubte Partei eine Renaissance. 2004 gelang den Rechtsextremen in Sachsen erstmals seit über dreißig Jahren der Einzug in ein deutsches Landesparlament. Auch in Mecklenburg-Vorpommern überwand die Partei die Fünf-Prozent-Hürde, ebenso gelangen ihr Erfolge im Saarland und Thüringen.
Über 20 Jahre nach dem Karlsruher Urteil nutzt der Verfassungsschutz kaum noch V-Leute für seine Arbeit. In manchen Ämtern, wie etwa Thüringen, hat man dem nahezu vollends abgesagt. Das liegt auch daran, dass sich der politische Diskurs maßgeblich ins Internet verlagert hat. Dort setzen sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch die Landesämter mittlerweile unzählige Fake-Accounts ein, um die Aktivitäten von Extremisten ausspähen zu können. Nach und nach wird dabei öffentlich, wie umfangreich das Netzwerk eigentlich ist.
Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in den sozialen Medien Fake-Accounts im dreistelligen Bereich nutzt (Apollo News berichtete). Auch in Berlin nutzt der dortige Verfassungsschutz mehrere hundert Accounts, wie Nius am Donnerstag berichtete. In Thüringen, wo der Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer, nach den Enthüllungen der Kramer-Affäre (Apollo News berichtete exklusiv), unter Druck steht, wurde bereits im November durch ein Gericht die Offenlegung der Nutzung von Fake-Accounts angeordnet.
Werbung
Angesichts des offensichtlich breiten Netzwerks an verschiedenen Accounts, die die verschiedenen Ämter für Verfassungsschutz im Internet für ihre Zwecke einsetzen, stellen sich mehrere Fragen. Wofür genau werden die Accounts benutzt? Was sind ihre Befugnisse? Manipulieren sie die öffentliche Wahrnehmung extremistischer Gruppen?
Lesen Sie auch:
Berlin
Überlastung der Justiz: Jetzt soll Künstliche Intelligenz Asylverfahren beschleunigen
In Berlin und Niedersachsen soll in Zukunft Künstliche Intelligenz bei Asylverfahren eingesetzt werden und so die richterliche Entscheidungsfindung erleichtern und vor allem beschleunigen.Bayern
„Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung“: Stadt Augsburg bestätigt Aufenthaltsverbot für rechten Aktivisten Sellner
Die Stadt Augsburg hat das Aufenthaltsverbot für den rechten Aktivisten Martin Sellner bestätigt. Die Stadt habe die Aufgabe, „die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ aufrechtzuerhalten. Dazu würde als Schutzgut auch die verfassungsmäßige Ordnung zählen.Über das Vorgehen der Fake-Accounts ist öffentlich wenig bekannt. In einer Antwort auf eine entsprechende kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Ferdinand Mang hielt sich beispielsweise die Bayerische Landesregierung bedeckt. Das Landesamt für Verfassungsschutz erteile „grundsätzlich keine öffentlichen Auskünfte über Details zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel“. Als Begründung heißt es: „Aus dem Bekanntwerden derartiger Details könnten Rückschlüsse auf Vorgehensweise, Fähigkeiten und Methoden des BayLfV gezogen werden (…)“.
Aus einer kleinen Anfrage des Berliner AfD-Abgeordneten Ronald Gläser gehen aber immerhin die Plattformen hervor, auf denen das dortige Landesamt solche Fake-Accounts einsetzt. Freilich sind dort große Plattformen wie etwa X (insgesamt 36 Fake-Accounts), Instagram (37) oder Facebook (59) vertreten. Auch auf kleineren Plattformen, etwa Mastodon oder Gab, hat der Berliner Verfassungsschutz eine Inkognito-Präsenz.
Werbung
Ausgerechnet der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer liefert einen weiteren Inhaltspunkt für die Arbeit des Verfassungsschutzes im Netz. Immer wieder betont der aussagefreudige Amtschef in Interviews die Arbeit seines Amtes im digitalen Leben. Beispielsweise setzt das Amt mittlerweile auch Mitarbeiter in Online-Videospielen ein. Auch hier nennt Kramer zwar keine Details, offensichtlich müssen die Amtsmitarbeiter jedoch so wohl in nicht-öffentliche Gruppen und Chats kommen, um Extremisten ausspähen zu können.
So läuft es vermutlich auch auf anderen Plattformen. Die Verfassungsschützer haben dabei sogar in bestimmten Fällen das Recht, Straftaten zu begehen. So etwa kann ein Mitarbeiter mit einem Fake-Account volksverhetzende Beiträge in den sozialen Medien erstellen, ohne dafür belangt werden zu können.
Schnell kann der Verfassungsschutz damit auch selbst zum maßgeblichen Treiber für extremistische Inhalte werden. Diese Gefahr besteht dabei insbesondere angesichts der schieren Größe des Netzwerks. Allein der Verfassungsschutz Berlin unterhält 236 solcher Fake-Accounts und das als relativ kleines Amt, mit insgesamt nur rund 250 Mitarbeitern.
Werbung
Man kann daher wohl davon ausgehen, dass in Bundesländern mit größeren Ämtern, etwa Bayern und Baden-Württemberg, die teilweise mehr als doppelt so viele Bedienstete haben wie der Berliner Verfassungsschutz, auch jeweils mehrere hundert Fake-Accounts führen. Demgemäß könnte die Zahl solcher Fake-Accounts in den sozialen Medien sehr wohl mehrere Tausend betragen.
Der Verfassungsschutz hat damit eine mächtige Maschinerie aufgebaut, die wohl den früheren Einfluss von V-Männern auf die Öffentlichkeit weit übersteigt. Dabei liegen die genauen Ziele des Apparats immer noch größtenteils im Dunkeln. Dem deutschen Inlandgeheimdienst und seinen Landesämtern muss dabei aber auch klar sein, wie gefährlich der so breit gestreute Einsatz von Fake-Accounts sein kann.
Die Arbeit des Verfassungsschutzes steht aufgrund dessen weitreichenden Befugnissen und ganz insbesondere im Licht aktueller Skandale besonders auf dem Prüfstand. Diskreditiert sich der Verfassungsschutz selbst, könnte das auch Folgen für das Ansehen des Rechtsstaats haben.
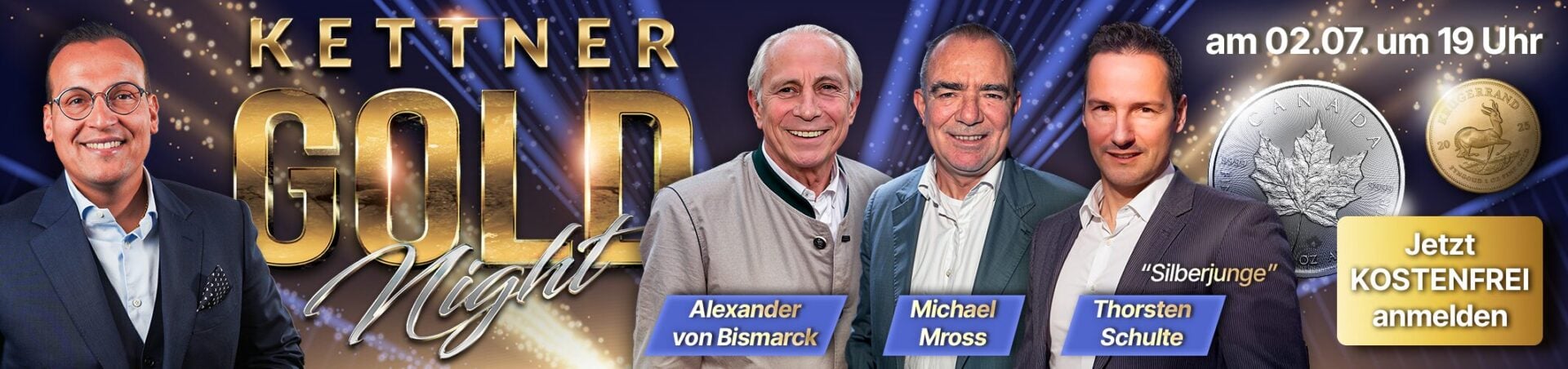


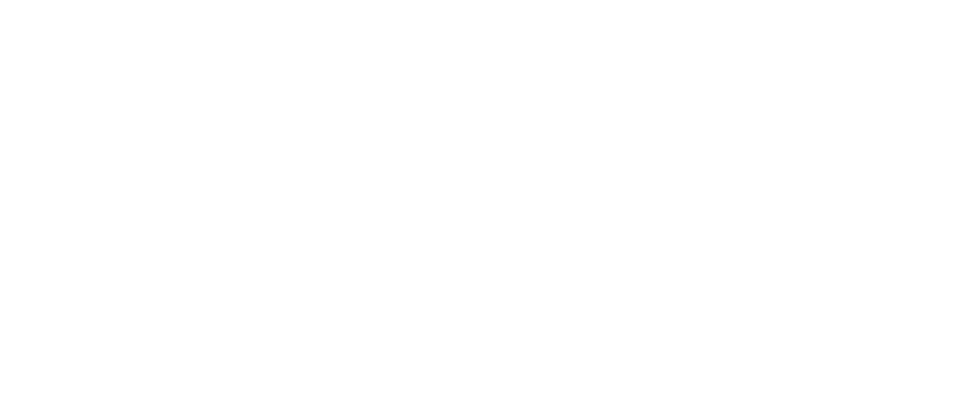
„Diskreditiert sich der Verfassungsschutz selbst, könnte das auch Folgen für das Ansehen des Rechtsstaats haben.“
Welcher Rechtsstaat? Wir haben diesen bereits vor Jahren abgeschafft.
Es gibt nur eine Lösung für diese Abgründe und Verwerfungen: Verfassungsschutz abschaffen. Eine gestandene Demokratie kommt ohne eine solche Krake aus.
Warum leistet sich eine Regierung einen solchen Geheimapparat gegen die eigenen Bürger?
Mir fallen zwei Gründe ein:
1. Wenn wir es mit politischen Ideologen zu tun haben, so brauchen diese immer ein Feindbild, an dem sie sich abarbeiten können. Wenn sich nicht freiwillig Feindfiguren zur Verfügung stellen, muss man welche kreieren.
2. Eine Regierung, die dauerhaft gegen die Interessen der Bürger regiert, hat Angst vor politischen Gegnern und fürchtet den Machtverlust.
Mit dem Schutz der Demokratie hat das in beiden Fällen nichts zu tun.
Im Gegenteil: eine starke Demokratie entsteht durch ein hohes Maß an bürgerlicher Freiheit. Menschen, die nicht ständig mit Verboten und Einengungen drangsaliert werden, neigen nämlich nicht dazu, sich zu „radikalisieren“. Eine geringe Zahl an Extremisten gibt es wohl überall, aber eine lebendige Demokratie kann das verkraften und ihr mit dem normalen Rechtsstaat begegnen, denn sie stellen keine Bedrohung für die Gesamtgesellschaft dar.
Was passiert, wenn Schlapphüte bei ihrer „Arbeit“, eigenen verfassungsfeindlichen Zielen im Netz nachgehen? Gibt es da auch solche ominösen Meldestellen oder spionieren die Spione den eigenen Spionen nach? Das NSU Debakel des Verfassungsschutzes in Kassel ist bis heute nicht aufgeklärt, oder?
Da die sozialen Netzwerke eine globale Reichweite haben, im Gegensatz zum lokalen Stammtisch, tragen diese Fake-Accounts einen weitaus grösseren Beitrag bei, zur Verbreitung verfassungsfeindlicher Inhalte, als der 0815-Nutzer dieser Plattformen.
Die Selbstverstärkende Wirkung, ihrer (legal-)illegalen Inhalte ist hier potenziert.
Mindestens eine solche dem Verfassungsschutz nahestehende Quelle steht im Verdacht, auch auf diesen Seiten aktiv zu sein und die Leser durch detailfreudige Berichte über den Zustand ihrer Verdauung zu belustigen.
Alles Fake News. Die Verfassungsschutzämter verteidigen nur „Unsere Demokratie“. Basta!
Dienen diese Fake-Acounts der Überführung von Straftätern oder werden sie zur Diskreditierung
unliebsamer politischer Meinungen und Personen eingesetzt?
Wie im Kommunismus, da wurden auch Straftaten provoziert, um Bürger in die Falle laufen zu lassen.
Dumm nur, das sie ihren eigenen Gesinnungssoldaten zum Opfer gefallen sind, die alles melden und löschen lassen. 😀 Mit jedem Tag wird deutlicher von welchen Vollidioten wir regiert werden.
Verfassungsschutz und Rechtsstaat…Pinocchio am Küchentisch.
Aha, der VS meldet sich zu Wort …
Und wenn mal wieder ein islamistisch motivierter Terroranschlag verhindert wurde, heißt es, der Hinweis kam von einem „ausländischen Geheimdienst“.
Kein Wunder, unsere eigenen Dienste sind vollauf damit beschäftigt Bürgern nachzuspionieren, denen in vielen Fällen nichts vorzuwerfen ist, außer eine andere Meinung zu haben, die rechts von dem ist, was in Berlin gerade angesagt ist.
Oder die sich in Thermodynamik auskennen oder Außenpolitik und deshalb zu einer unvorteilhaften Meinung über die zuständigen Minister gekommen sind.
DDR & EUDSSR.
Nur die AfD kann uns retten.
Das Smartphone ist ein technisch hochentwickeltes Gerät, allerdings eine komplett technische Fehlentwicklung.
Die Nutzer sind nichts anderes als Menschen mit grafischem Terminal mit dem telefoniert werden kann.
Der VS und andere aus dem Deep State können jedem Nutzer einen Bundestrojaner unterschieben und sogar Straftaten damit begehen um den Nutzer zu belasten.
Es ist in der Vergangenheit schon auf dem normalen PC passiert.
Siehe ccc 2007 „BGH-Entscheidung zur Online-Durchsuchung: Schnüffeln auf privaten Rechnern“
Die Bundesregierung „Für den Fall, daß von den BGH-Richtern die Zulässigkeit verneint wird, haben Koalitionspolitiker bereits angekündigt, den Richterspruch zu ignorieren und eine gesetzliche Regelung zu schaffen, diese Maßnahme als normale polizeiliche Ermittungsmethode zuzulassen.“
Beatrix von Storch rechnet mit Haldenwang und Kramer ab!
im BT
https://www.youtube.com/watch?v=SzxyB7P78b0 5 Min.
Superrede von Frau von Storch !!!!
https://youtu.be/SzxyB7P78b0
Wie? Arbeitet der VS mit denselben fiesen Methoden gegen die AfD, wie damals gegen die NPD?
Wenn die Behauptungen nicht mit der Realität übereinstimmen, müssen eben eingeschleuste V-Leute aushelfen, um was gegen die AfD zu finden.
Unsere Demokratie wird von linksintellektuellen Seilschaften bedroht und nicht vom patriotischen Bürgertum.
Ein Geheimdienst legt fake accounts nicht nicht an, um sie nicht zu nutzen. Man muss das Szenario herausfinden, wofür es möglicherweise im Interesse des Geheimdienstes nützlich sein kann. Dabei wird man möglicherweise auf falsche Spuren, Verschwörungstheorien usw. gelockt, was 188 StGB auf den Plan ruft. Dann wäre schon einmal ein Ziel für den Geheimdienst erreicht, von dem/den wahren Szenario/Szenarien abzulenken. Unsicherheit, Einschüchterung sind bessere Arbeitsbedingungen für diese Dienste. Es gibt zunächst das Interesse, die Hauptattentäter und Rädelsführer zu identifizieren, wofür man aber keine 36, 57 und 59 fake accounts auf jeweils einer einzigen Plattform benötigt. „Bestbewertet“ ist hier default Anzeige-Reihenfolge. Man kann die Reihenfolge der Kommentare von außen beeinflussen, so dass ein „gefährlicher“ Kommentar nach unten rutscht und somit weniger sichtbar werden würde, je nach Gesamtzahl der Kommentare nahezu ganz verschwindet. Weiter beobachten! Analyse der Clicks?
Zwei kurze Anmerkungen: Laut Bundesverfassungschutzgesetz § 9a dürfen „Verdeckte Mitarbeiter … weder zur Gründung von Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 noch zur steuernden Einflussnahme auf derartige Bestrebungen eingesetzt werden. Sie dürfen in solchen Personenzusammenschlüssen oder für solche Personenzusammenschlüsse, einschließlich strafbare Vereinigungen, tätig werden, um deren Bestrebungen aufzuklären. …“ Entscheidende Frage: Wo beginnt jenseits der Neutralität die steuernde EINFLUSSNAHME? Ansonsten geht aus dem Antrag für ein AfD-Verbot des Bundestags hervor https://dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013750.pdf , dass dafür „strikte STAATSFREIHEIT“ herrschen muss, „insbesondere sind die vom Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesverfassungsschutzbehörden zum Zwecke der Erfüllung ihrer nachrichtendienstlichen Aufgaben eingesetzten V-Leute rechtzeitig abzuschalten bzw. abzuziehen“. Das hieße wohl, auch Fake-Accounts von Verfassungsschützern wären ein Problem?
Die Arbeit des Verfassungsfeinde hat längst Auswirkungen auf den politischen Kurs. Denn dank Herrn Haldenwang ist der Verfassungsschutz nicht mehr neutral, sondern auf einem Feldzug gegen die unliebsame Opposition.
Dies unter anderem durch die Hilfsmaßnahmen von Fakeaccounts zu tun zeigt die Perversion des Kampfes. Aufhetzen und anheizen der Leute, die massiv unter der Politik leiden, bei sicherer Straffreiheit, sollte juristisch beurteilt werden. Vertrauen in Staat und Verfassungsschutz, die sich so verhalten? Sicher nicht. Mein Vertrauen ist hinüber. Verantwortlich zeichnen sich die Altparteien und der VS mit ihrem Verhalten dem Volk gegenüber.
Die neue Stasi
Und die Grünen Lügenbolde um die deutsche Außenministerin faseln immer irgendetwas von russischen 🇷🇺 Trollen und russischer Einflussnahme auf die Politik. Alles Lüge es sind ihre eigenen Leute 🕵🏼♀️vom Verfassungsschutz die mit Fake Account’s die Leute zu Straftaten anstacheln wollen (Agent Provokateur). Sie haben es hier auf Apollo News auch mehrfach versucht das haben wir aber durchschaut es ist leicht die VS -Deppen zu identifizieren Sie können einfach nicht denken und handeln wie wir Konservativen weil sie alles deutsche Hassen und verachten. Sie fühlen nicht deutsch und genau das merkt man ihnen an, das kann man auch nicht erlernen lieber VS.🇩🇪. Und so wird wieder ein Puzzlestein hinzugefügt und das Bild wird immer klarer Sie Lügen immer dreister.
Wenn diese Leute auf den Plattformen hetzen dürfen, dann müsste der Plattformbetreiber doch dieses löschen, oder? Welchen Sinn macht das dann, außer einer aufgeblasenen – und eventuell einseitigen – Statistik, die zu einer Stellenmehrung und restriktiveren politischen Maßnahmen animiert?
Ich les immer Spiel…
Wieso werden die Betrügereien des VS als „gefährliches Spiel“ bezeichnet?
Das hört sich doch eher an als wäre das Ganze Spaß, dabei geht es hier um Recht und Gerechtigkeit, sowie die letzten Reste der Demokratie, die zerstört werden sollen, von einem Netzwerk im Tiefen Staat.