Gesetzesänderung zum Verfassungsgericht: Der problematische Hintergedanke einer Anti-AfD-Reform
Die Reform des Grundgesetzes, angeblich zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor „extremistischen Kräften“, ermöglicht es, die AfD von der Richterwahl auszuschließen. Unter dem Vorwand, die Funktionsfähigkeit des Gerichts zu sichern, wird die politische Realität ausgehebelt.

CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke haben am Donnerstag mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Reform der Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes beschlossen. Konkret werden in diesen Artikeln die Bestimmungen und Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts geregelt. Ziel der Reform ist es, das Verfassungsgericht „resilienter“ zu machen und vor „extremistischen Kräften“ zu schützen.
Lediglich das BSW und die AfD stimmten gegen den Gesetzentwurf. Dies wurde im Vorfeld erwartet, da die Reform insbesondere darauf zielt, der AfD Einflussmöglichkeiten auf das Bundesverfassungsgericht zu verwehren. Der Gesetzentwurf wurde mit 600 Ja-Stimmen bei 69 Gegenstimmen angenommen.
Zwar muss der Bundesrat der Änderung noch zustimmen, mit Widerstand ist hier jedoch nicht zu rechnen. Größtenteils zielt die Änderung darauf ab, bisher lediglich einfachgesetzliche Modalitäten, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz verankert waren, nun auch verfassungsrechtlich festzuschreiben. Demnach wird die Amtszeit der Richter auf zwölf Jahre begrenzt.
Die Wiederwahl eines Richters ist ausgeschlossen. Zusätzlich soll eine Altersgrenze von 68 Jahren für die Richterschaft eingeführt werden. Wer diese erreicht, scheidet grundsätzlich aus dem Bundesverfassungsgericht aus. Des Weiteren soll die Anzahl der Richter auf 16 (je acht pro Senat) festgelegt werden und die Existenz von zwei Senaten verfassungsrechtlich vorgeschrieben werden.
Werbung
All dies stellt keine Änderung zur bisherigen Rechtslage dar. Sollte der Bundestag jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal die Struktur des Verfassungsgerichts ändern wollen, wäre ab sofort eine Zwei-Drittel-Mehrheit anstatt einer einfachen relativen Mehrheit erforderlich. Weder die AfD noch das BSW hatten allerdings im Vorfeld kundgetan, hieran Änderungen vornehmen zu wollen.
Lesen Sie auch:
Kleine Anfrage
Seit 2015 hat sich der Anteil von Nichtdeutschen in Brandenburger Gefängnissen auf 40 Prozent verdoppelt
40 Prozent der Gefangenen in Brandenburger Gefängnissen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit, wie die Landesregierung auf eine Anfrage der AfD bekanntgab. Die Vornamen der deutschen Gefangenen gab die Landesregierung hingegen nur unvollständig preis.CDA
Nach SPD-Parteitagsbeschluss: CDU-Arbeitnehmerflügel unterstützt AfD-Verbotsverfahren
Die SPD erhält für ihren Parteitagsbeschluss, der ein AfD-Verbotsverfahren fordert, Rückendeckung aus der Union: Die CDA-CGB-Arbeitsgemeinschaft, die ebenfalls ein Verbotsverfahren fordert, sieht sich dadurch bestärkt.Entscheidend ist jedoch die Änderung zum Ersatzwahlmechanismus. Bisher stand fest, dass die Bundesverfassungsrichter je zur Hälfte vom Bundestag oder vom Bundesrat gewählt werden. Dies wurde nun de facto revidiert. Bisher war der Ersatzwahlmechanismus lediglich in Paragraf 7a des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgeschrieben.
Dieser sieht vor, dass das Bundesverfassungsgericht selbst einen Kandidaten für die Position eines neuen Verfassungsrichters vorschlagen kann, wenn im parlamentarischen Wahlausschuss des Bundestags keine Einigung mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit erzielt wird.
Werbung
Diese Regelung stieß bereits in der Vergangenheit auf Kritik, da sie dem Verfassungsgericht eine indirekte politische Rolle zuweist, die über seine eigentliche rein juristische Funktion hinausgeht. Die Regelung bringt das Gericht in eine Position, in der es zumindest teilweise an der politischen Gestaltung mitwirkt, was die vorgesehene strikte Trennung zwischen Judikative und Legislative verwischt.
An dem Vorschlagsrecht des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen des Ersatzwahlmechanismus soll jedoch festgehalten werden. Nach Artikel 93 des Grundgesetzes in der neu vorgesehenen Fassung kann darüber hinaus nun das jeweilige andere Verfassungsorgan die Wahl der Verfassungsrichter durchführen, sofern sich Bundestag beziehungsweise Bundesrat nicht mit Zwei-Drittel-Mehrheit auf die Wahl eines Richters verständigen können.
In dem Gesetzentwurf heißt es konkret, dass man durch die Verfassungsänderung zur „Auflösung von Wahlblockaden“ beitragen wolle. Der von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP eingebrachte Gesetzentwurf zielt also dem Wortlaut zufolge darauf ab, parlamentarische Obstruktion zu unterbinden und die Funktionsfähigkeit des Bundestags zu schützen. Man wolle verhindern, dass destruktive Kräfte die Arbeit des Parlaments behindern oder gar lahmlegen können.
Werbung
Andererseits eröffnet man sich hier jedoch ein Einfallstor zur scharfen institutionellen Ausgrenzung der AfD. Da sich die Regelungsänderung offensichtlich gegen das BSW und vor allem die AfD richtet, liegt es auf der Hand, dass in der Verfassungswirklichkeit insbesondere das Wahlrecht des Bundestages und damit seine verfassungsrechtlich immanent festgeschriebene „Kreationsfunktion“ beschnitten werden soll.
Der Bundesrat und damit auch die Exekutive der Länder erfahren dagegen indirekt eine Aufwertung. Sofern die Länderregierungen weiterhin von SPD, CDU, Grüne und FDP gestellt werden, besteht also die Möglichkeit, die AfD weiterhin von der Wahl der Verfassungsrichter auszuschließen, selbst wenn sie ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag stellt. SPD, CDU, Grüne und FDP ermöglicht die Neuregelung damit ein Einfallstor zur Ausblendung der politischen Realität.
Seit Jahren stellen CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP gemeinsam die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag für die Wahl der Verfassungsrichter. Hieraus hat sich eine informelle Praxis der Vorschlagsrechte etabliert. Demnach schlagen CDU/CSU und SPD jeweils drei Richter pro Senat vor, während Grüne und FDP je einen Richter nominieren dürfen. Durch diese Vorschlagspraxis erreichten die vorgeschlagenen Richter stets problemlos die Zwei-Drittel-Mehrheit.
Werbung
Durch das Erstarken der AfD sowie dem Aufkommen des BSW bröckelt nun dieser Konsens. Ausweislich soll durch die Verfassungsänderung die Blockade des Parlaments durch die AfD verhindert werden. Tatsächlich eröffnet die Reform jedoch der Union, der SPD, den Grünen sowie der FDP die Möglichkeit zur Blockade und die Durchsetzung der eigenen Richterkandidaten. Unter dem Deckmantel des Schutzes gegen „extremistische Kräfte“ wollen sie ihre Stellung im Bundesverfassungsgericht behaupten.
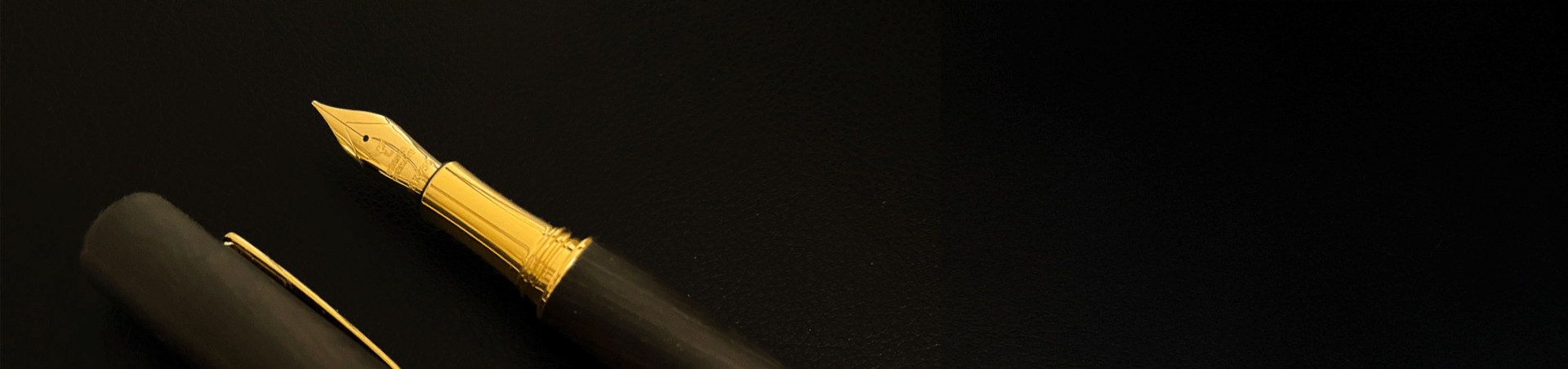
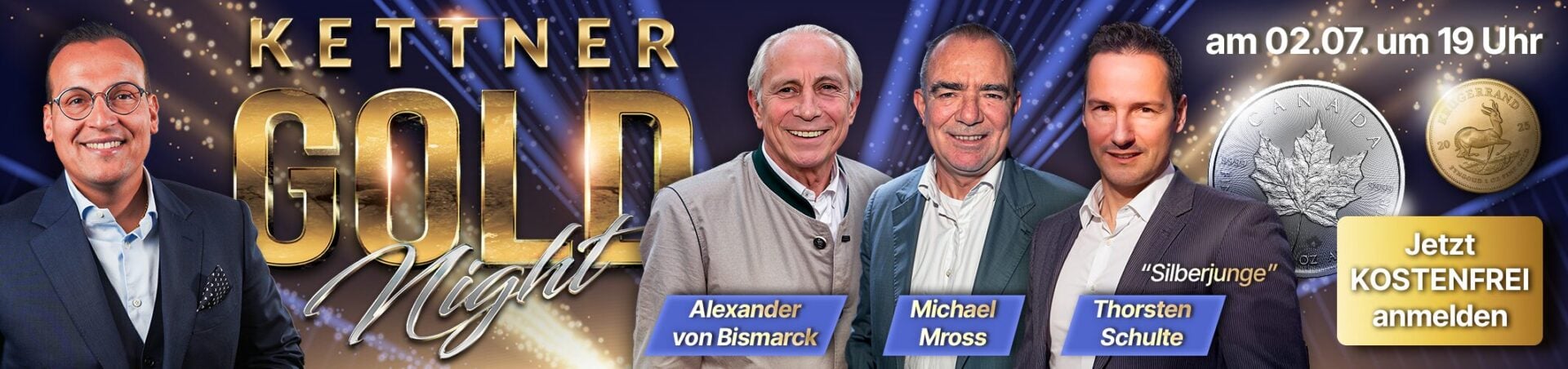



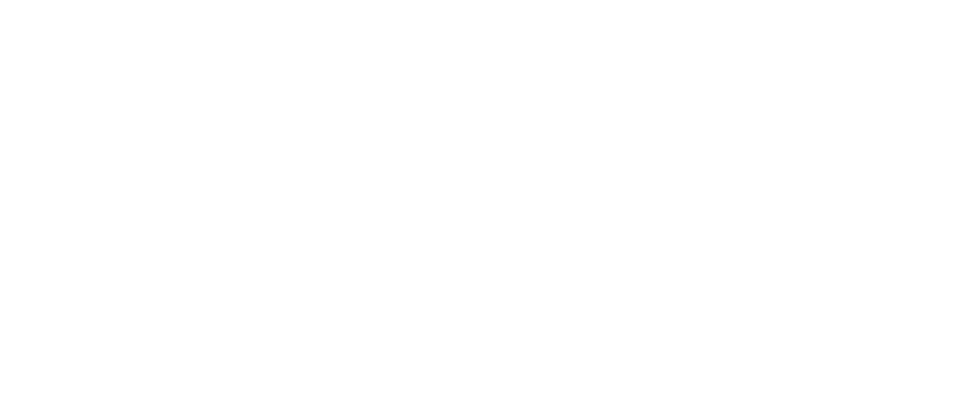
Demokratie in Deutschland ist, wenn die Verlierer einer Wahl entscheiden wer gewonnen hat und freie Meinungsäußerung bedeutet, du darfst deine Meinung sagen, es muss nur die Richtige sein!
Rechtsstaat war gestern !
Es ist eine Schande was Medien Propaganda aus diesem Land macht !
Gehirnwäsche und Doppelmoral und Lügen sind
inzwischen Standard !
Lupenreine Demokraten….
Das , zeigt ganz klar wohin die „Reise“ geht!
Demokratie ade….
Ehrlich gesagt, interessieren mich die Einzelheiten der weiteren Selbstzerstörung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland nicht mehr so sehr. Die eigentliche Aufgabe des BVerfG bestünde doch darin, die Grundrechte der Bürger vor einer übergriffigen Politik zu schützen. Da hat es sich schon länger als Totalausfall erwiesen – siehe die Beschlüsse zum „dritten Geschlecht“ (m/w/d-Stellenausschreibungen), zur „Klimaschutz“-Verpflichtung des Staates, zur „Bundesnotbremse“ und zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Alle diese Beschlüsse tragen die Handschrift der Richterinnen Baer und Britz, die von den Grünen nominiert und von den anderen Parteien durchgewunkenen wurden und denen die meisten ihrer von CDU und SPD nominierten Richter kritiklos gefolgt sind. Ich erwarte vom BVerfG schon lange keinen vernünftigen Gedanken mehr.
Ich dachte Richter sind unabhängig?
so ist das auf der welt.
sieger schreiben geschichte
und machtinhaber schaffen gesetze.
seltsam nur, dass alle mitgliedslaender der union kuschen und wegschauen.
gerade diejenigen, welche staendig selber der rechtsstaatlosigkeit von ursel angeklagt wurden, muessten sich doch jetzt mal zusammentun, und diese vorgaenge lautstark vor der welt kritisieren.
Nach dem totalen Zusammenbruch sollte als erstes eine neue Verfassung vom Volk beschlossen werden. Unter anderem muss festgeschrieben werden, dass Kanzler, sämtliche Verfassungsrichter und Generalbundesanwälte von den Bürgern gewählt werden müssen und niemals einer Partei angehört haben dürfen. Niemals mehr darf es möglich sein, dass sich die Parteien den Staat zur Beute machen.
Mein Vorschlag zum Unwort des Jahres „Unseredemokratie“
Ausgrenzung von Personen einer politischen Meinung, Arbeitsverbot und Ausgrenzung bzw. Verfolgung in der Öffentlichkeit. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ach ne, das war die Religion. Wobei das auch nicht mehr weit ist. Als Christ ist man ja nun auch schon kurz vor Verfolgung.
Schön, wie diese Demokratie in Deutschland funktioniert. Manche könnte meinen, dass die neue Demokratie der SED Parteien eher eine Diktatur ist, aber das ist natürlich nicht wahr 😉
Die lupenreinen Demokraten unter sich. Die üppigen Töpfe mit keinem teilen wollen.
Der Deutsche Michel fühlt sich anscheinend in der Demokratie nicht wohl, wie sind sonst die Wahlergebnisse zu erklären. Die Grünen halten ja mit ihren Absichten nicht hinter dem Berg, sondern sagen ganz deutlich, wie sie Demokratie definieren.
Man nahm Polen als Argument. Dort hatte die einst regierende, rechtsnationale Partei PIS Einfluss auf das Verfassungsgericht genommen. Das wollte man, so wird argumentiert, hier in D verhindern, aber schaffte genau das selbe wie in Polen, nur in die andere politische Richtung.
Seit Merkel rückte die CDU nach links. Die Brandmauer gegenüber Links ist weg, in Thüringen gar eine Koalition mit Ultralinks eingegangen, mit Duldung von Extremlinks, weil selbst der Dreier keine Mehrheit hat. Ein ehemaliger Stasimitarbeiter wurde Umweltminister.
Nun kann man 1+1 zusammenzählen und feststellen, dass das Verfassungsgericht nach links gerückt werden soll.
Den Fehler begingen aber schon unsere GG- Väter/Mütter. Das Verfassungsgericht sollte frei von Parteibuchrichtern sein. Man hätte festschreiben müssen, dass nur parteiisch unabhängige Richter zu Verfassungsrichtern gewählt werden sollten.
Die Weichen zum Linksruck des VS wurden gestellt. Demokratie wird zur Farce, Scheindemokratie droht.
Moin, wenn ich immer lese die Demokratie ist in Gefahr und wir müssen Sie schützen.
In Deutschland gab und gibt es keine Demokratie.
Weder im Westen noch im Osten wurde demokratisch gehandelt.
Keiner aus der Wählerschaft hat Einfluss auf die Kandidaten.
Kein Bürger hat irgendwelchen Einfluss auf Entscheidungen in der Politik.Kreuz auf Wahlzettel ansonsten stillhalten.
Nur wer Macht hat entscheidet.
Warum wurde im Westen kein Bürger politisch geschult.
Weil der Durchblick nicht gewollt war.
Alles wird in Hinterzimmern ausgeklüngelt.
Und Wahlen wenn sie was verändern würden ,hätte man Sie lange abgeschafft.
Jetzt merkt jeder das es nicht legitim ist und bekommt Schweissausbrüche.
Der Osten hat klar aufgedeckt was Wahlen wert sind.
Und die Neuwahlen werden genauso.
So schaut’s aus.
Langsam aber sicher, werden auch die letzten wach, denn das neuerliche Urteil vom LG Berlin II
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gericht-sieht-falschen-eindruck-zum-potsdamer-treffen
wird der Kaste nicht gefallen, aber wie gesagt, auch wenn sie jetzt versuchen, und das tun sie mit aller Macht, kommen alle Lügen ans Licht, und der Bürger wird diesmal nicht vergessen.
Die Feinde der Demokratie kommen NICHT von rechts!
Was mich immer wieder wundert, ist. daß unsere Regierungsmitglieder offenbar nicht intellektuell in der Lage sind, sich vorzustellen, daß so ein Gesetz auch mal gegen sie gewendet werden könnte, wenn die andere Seite an der Regierung ist. Ein kluger Mensch würde sowas doch vorher mitbedenken.
Der nächste Schritt Richtung 1933…ja, klar, der Kommentar wartet mal wieder. Hat eine böse Zahl drin.
Es geht in der gesamten Politik offenbar nur noch darum die AfD vom demokratischen Prozeß auszuschließen. Keine Finanzierung, keine Zusammenarbeit, kein Diskurs, Ausschluß aus Ämtern uvm.
Die Wähler von SPD, CDU, Grüne und BSW sollten sich dringend überlegen, was sie unserem Land antun.
Hätten wir ein Verfassungsgericht, müsste es diesen Gesetzesentwurf als verfassungswidrig an das Parlament zurückweisen!
Interessant ist, dass im GG nicht festgelegt wurde, wann eine Wahl als gescheitert gilt, weil keine 2/3 Mehrheit zustande gekommen ist und die Wahl dann jeweils an den Bundesrat bzw. Bundestag abgegeben werden muss. (Oder habe ich das Übersehen).
Das heißt dieses wird über ein „normales Gesetz“ geregelt?
Hier kann man also frei mit einfacher Mehrheit festlegen, wieviel Wahgänge es geben kann oder wann Fristen ablaufen etc.
Ein Ansatzpunkt für künftige Regierungen um doch noch etwas Einfluss nehmen zu können?
Auf der anderen Seite, ist es gut, richtig und überfällig, dass dieses jetzt Verfassungsrang hat.
Dieser Beschluss, das ist vielen gar nicht bewusst, ist ein Stich ins Herz der wahren Demokratie.
Es wird verboten, zensiert, getrickst, korrumpiert und gelogen, dass sich die Balken biegen.
Alles für den Machterhalt. Da sind natürlich unabhängige Verfassungsrichter ein enormes Hindernis. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit bis auch diese letzte und wichtigste Bastion noch fällt. Ja nun ist es soweit. Jetzt können endlich alle echten Oppositionsbestrebungen wirksam bekämpft werden. Frau Faser und Konsorten können verbieten, was sie wollen. Haushalte können trotz fundamentaler Ungereimtheiten verabschiedet, unliebsame Gegner verboten werden und das schlimmste ist, Wahlen können á la Rumänien annulliert werden, wenn sie nicht passen. Und der deutsche Michel? Der guckt nur dumm zu. Unglaublich!
Wie sagte einst Westerwelle: die Freiheit stirbt scheibchenweise ( Karl Hermann Flach-Zitat).
Seit geraumer Zeit bereits wird unsere Demokratie in eine sozialistisch-totalitäre Diktatur umgebaut.
Im Artikel von gestern ging es noch um eine geplante Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, nunmehr um ein Änderung im Grundgesetz – was denn nun ?
Welches Gesetz schützt das Volk vor linken Faschisten, die die Demokratie vorsätzlich demontieren und das Volk entmündigen? Das Volk bestimmt in einer Demokratie, was Demokratie ist und wie sie gelebt wird, nicht ein Haufen von ein paar hundert „linken faschistischen Volksvertreter“.