Zuckerbergs historische Wende zur Meinungsfreiheit: Für Correctiv & Co. ist die Party vorbei
Mark Zuckerberg verkündete großangelegte Reformen für seine Plattformen, ein Ende von Faktencheckern und der „Zensur“, die – wie er selbst zugibt – bisher zu oft herrschte. Es ist ein schwarzer Tag für die regelrechte Zensurindustrie, die sich um Correctiv & Co. gebildet hat - und ein Sieg für die Meinungsfreiheit.

Es dürfte ein schwarzer Tag für die Welt der Faktenchecker sein: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verkündete am Dienstag die wohl einschneidendste Reform seines Meta-Konzerns in den letzten Jahren. Praktisch den gesamten Umgang mit Meinungsfreiheit und Zensur auf seinen Plattformen Facebook und Instagram will er jetzt auf den Kopf stellen. Bisher habe es „zu viel Zensur“ gegeben, gesteht er ein und will jetzt dem Modell von Elon Musks X (ehemals Twitter) folgen.
Eine der ersten Institutionen, die wegfallen sollen, sind von Facebook lizensierte Faktenchecker wie Correctiv. Sie werden auf den Plattformen nichts mehr zu sagen haben, stattdessen setzt man auf Community Notes, also Anmerkungen der Nutzer, nach dem Vorbild von X. Damit verlieren die Faktenchecker ihre prominente Rolle als vermeintliche Wächter der Wahrheit in den sozialen Medien.
Völlig neu ist Zuckerbergs Wende nicht, aber ihr Umfang durchaus: Bereits vor einigen Monaten hatte der Facebook-Gründer öffentlich über den Zensur-Druck der US-Regierung auf seinen Konzern ausgepackt, Fehler eingestanden und sogar Lob für Trump gezeigt, den sein Konzern wieder zurück auf die Meta-Plattformen ließ – nach einem ursprünglichen Bann 2021 (Apollo News berichtete).
Jetzt geht Zuckerberg aber noch viel weiter als damals angedeutet: Wenn er Wort hält, will er auf seinen Plattformen wieder eine ähnliche Meinungsfreiheit wie jetzt auf Musks X herstellen. Und er spricht ganz offen über die vorangegangene Zensur – und wie ihr Beginn und nun anstehendes Ende mit der Person Trump zusammenhängt. Er spricht damit aus, was vielen seit Jahren klar war: Die Zensurwelle seit 2016 kam vor allem aus einem Schock über Trumps Sieg in der damaligen Präsidentschaftswahl – und andere Erfolge Rechter und Konservativer in der Zeit, wie etwa dem Brexit-Votum.
Werbung
Es begann 2016
„Nach Trumps Wahlsieg im Jahr 2016 schrieben die traditionellen Medien ununterbrochen darüber, dass Fehlinformationen eine Bedrohung für die Demokratie seien. Wir haben in gutem Glauben versucht, diese Bedenken auszuräumen, ohne uns selbst zu Schiedsrichtern der Wahrheit zu machen. Aber die Faktenprüfer waren einfach zu politisch voreingenommen und haben mehr Vertrauen zerstört als geschaffen“, gesteht Zuckerberg jetzt ein.
Lesen Sie auch:
„Big Beautiful Bill“
US-Repräsentantenhaus verabschiedet Trumps Steuer- und Ausgabengesetz
Das US-Repräsentantenhaus hat Trumps Steuer- und Spargesetz mit knapper Mehrheit beschlossen. Es verlängert Steuersenkungen von 2017, erhöht Freibeträge und kürzt Sozialausgaben.University of Pennsylvania
Lia Thomas bekommt Titel aberkannt – Trans-Schwimmer dürfen nicht mehr bei Frauenwettkämpfen starten
An der University of Pennsylvania dürfen künftig keine Männer mehr in Frauenwettkämpfen starten. Die Trans-Schwimmerin Lia Thomas, die im Frauenteam angetreten war, bekommt ihre Titel aberkannt.Er spricht auch ganz klar aus, wo bisher die Meinungsfreiheit auf Facebook und Instagram eingeschränkt war: Man werde „eine Reihe von Beschränkungen bei Themen wie Einwanderung und Gender abschaffen, die einfach nicht mit dem Mainstream-Diskurs in Einklang stehen. Was als Bewegung für mehr Inklusion begann, wird zunehmend dazu genutzt, Meinungen zu unterdrücken und Menschen mit anderen Ideen auszuschließen, und das ist zu weit gegangen.“
Damit dürfte er vielen Social-Media-Nutzern aus der Seele sprechen. Genau darüber beklagen sich Liberale und Konservative schließlich schon seit Jahren – wurden aber nur zu gerne als Verschwörungstheoretiker oder Freunde von „Hassrede“ dargestellt. Auch dass die Moderatoren in den sozialen Netzwerken selbst politisch links eingefärbt sind, gab Zuckerberg zu: Die entsprechenden Teams für Moderation will er vom linken Kalifornien ins konservative Texas verlegen, um kulturelle „Voreingenommenheit“ zu verringern – die ganz offensichtlich bisher vor allem von links kam.
Werbung
Jetzt kommen Europas Netzvorschriften in die Defensive
Auch für Deutschland wird all das weitreichende Auswirkungen haben: Aktuell wird Musks Umgang mit X vor allem als One-Man-Show eines vermeintlichen rechten Milliardärs angesehen, der hierzulande die Demokratie im Visier habe. Daher hat man gerade ihn und seine Plattform im Visier. All das dürfte künftig schwerer sein, wenn auf einmal alle großen Social-Media-Plattformen im Zweifel auf Meinungsfreiheit setzen.
Zuckerberg selbst hat in der Ankündigung scharfe Kritik an der EU in petto: „In Europa gibt es immer mehr Gesetze, die die Zensur institutionalisieren und es schwierig machen, dort etwas Innovatives aufzubauen“, erklärt er und reiht das in Beispiele von Zensur in China und lateinamerikanischen Ländern ein.
Gegen all das will er jetzt vorgehen – gemeinsam mit Donald Trump. Denn man könne „diesen globalen Trend nur mit der Unterstützung der US-Regierung zurückdrängen“, so der Meta-Chef, der auch die Biden-Regierung scharf kritisiert: „Deshalb war es in den letzten vier Jahren so schwierig, als selbst die US-Regierung auf Zensur drängte. Indem sie gegen uns und andere amerikanische Unternehmen vorging, ermutigte sie andere Regierungen, noch weiter zu gehen.“ Aber mit Trump habe man jetzt „die Gelegenheit, die freie Meinungsäußerung wiederherzustellen“, so Zuckerberg.
Werbung
Es ist ein beachtlicher Wandel – einer, der auch ganz klar mit Trumps erneuter Wahl zum US-Präsidenten verbunden ist. Meinungsfreiheit im Netz hatte er zu einem der Top-Themen gemacht. Die Wahl 2024 sei daher auch ein „kultureller Wendepunkt“, der zeige, dass die Wähler „der Redefreiheit wieder Priorität einräumen“, so Zuckerberg. Er verwies darauf, dass man jetzt zu Facebooks „Wurzeln“ zurückkehren wolle und gibt damit auch zu, dass sein Konzern sich über die Jahre davon weit entfernt hatte.
Im Kern ein Rebell
Zuckerberg selbst war sicher nie die treibende Kraft hinter der Zensur. Man erinnere sich: Er baute die Website, nachdem er sich zuvor in Harvard-Server hackte, Studentenbilder klaute und auf einer Website namens „Facemash“ von Nutzern die Attraktivität der Studenten ranken ließ. Das ist alles andere als „woke“, im Kern war er schon immer eher ein rebellischer Tech-Nerd – der aber im Jahr 2016 an der Spitze eines Milliardenkonzerns stand; eines Konzerns, den hyperventilierende Medien und Politiker als Mitschuldigen am Trump-Sieg sahen.
Damals geisterten alle möglichen linken Verschwörungstheorien herum, um den Wahlausgang zu erklären, der vielen so gar nicht ins Weltbild passte: Es waren die Russen – war der eine Gedanke. Oder „Cambridge Analytica“, ein Datenanalyse-Unternehmen, das in Sachen digitaler Wahlwerbung das Blaue vom Himmel versprach. Dass es schlichtweg Millionen der „forgotten Americans“ („vergessenen Amerikaner“) waren, die ihrem politischen Establishment den Mittelfinger zeigen wollten, glaubten nur wenige in Politik und Medien. Heute ist es anders: Trumps Comeback bewies einmal mehr, dass sein Sieg 2016 kein Ausrutscher war – konspirativ von Russland oder sonst wem geplant – sondern ganz reale politische Verhältnisse abbildet.
Werbung
Und Zuckerberg, der damals unter öffentlichem Druck seinen Konzern in eine Zensur-Welle mitreißen ließ, hat dementsprechend jetzt das Ruder herumgerissen. Gut so. Wichtig ist nur: Damit sollte er jetzt Ernst machen – und zwar auf Dauer. Und sich auch nicht von den nächsten US-Regierungen unter Druck setzen lassen, wenn dann wieder welche im Amt sind, die die Meinungsfreiheit nicht so hoch schätzen. Aber für Europas Social-Media-Nutzer ist all das erstmal eine Chance – erstmals in mehr als acht Jahren werden nun alle Plattformen staatliche und halbstaatliche Zensurversuche kritisch beäugen und bekämpfen, statt sie in vorauseilendem Gehorsam umzusetzen. Ein Sieg für die Meinungsfreiheit.
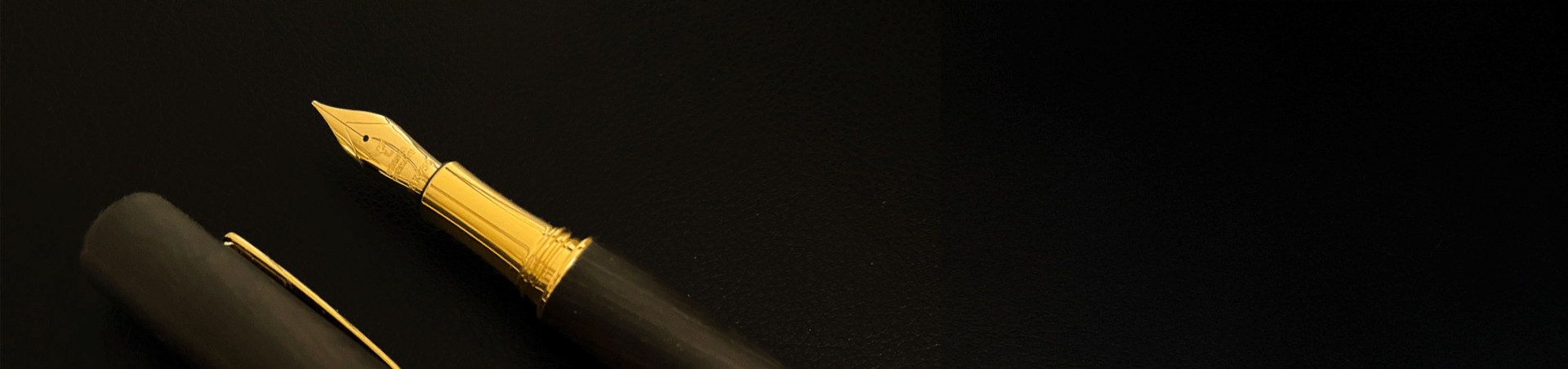



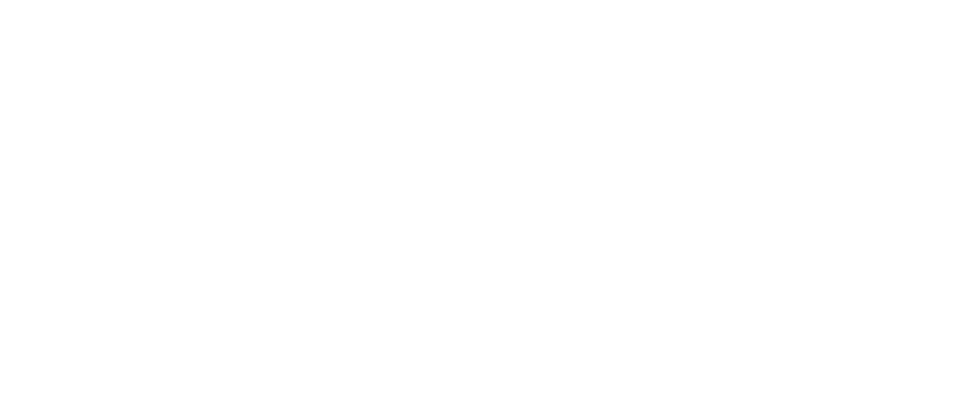
Ich hab’s schon mal hier geschrieben, lehnt euch zurück und wartet ab. Es wird sich Vieles wieder zum Guten wenden. Das ganze Schauspiel der Linken konnte nicht gut gehen. Die Realität ist so eine Sache….😁😉
ENDLICH geht es einmal wieder in Richtung NORMALITÄT zurück! Der Wahnsinn hat offensichtlich seinen Höhepunkt erreicht und die, die uns die ganze Zeit mit IHREM Irrsinn überschüttet haben, kommen wieder in die Ecke, wo sie hingehören!
Ich glaub das erst, wenn keiner mehr früh um 6 Uhr im Bademantel die Tür öffnen muss. Abwarten…
Er gibt also zu, das bei Facebook in den letzten Jahren die Meinungsfreiheit eingeschränkt war!!
Und das dank den sogenannten (mit Steuergeld finanzierten) Faktenchecker.
Hm, first-to Late!!! Ganz ehrlich, der hätte den Arsch doch nicht in der Hose gehabt das zu ändern wenn Trump nicht gewählt worden wäre. Wenn die Demokraten weiter an der Macht gewesen wären hätte Er das Zensur Lied weiter mit gesungen. Kein Wunder, wenn man weiß wer Facebook und Google wesentlich in Ihrer Entstehung mit Finanziert hat. Jetzt springt er auf den auf, klar. Auf X und TikTok ist mehr Freiheit als auf FB und YT.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Unangebrachte Euphorie.
So schnell wird niemand vom Saulus zum Paulus.
Abwarten und Tee trinken.
Wenn Zuckerhügel wirklich ernst meint und nicht eine Fahne im Wind ist, dann dürfte es für Linke sehr schwer werden. Denn in einem fairen Wettbewerb der Ideen (also ohne Zensur und cancel culture) verlieren die immer.
Er und viele seinesgleichen haben riesige Angst vor Trump und Co. Er ist ein Wendehals und wird bei nächster Gelegenheit wieder die Seiten wechseln, so wie es ihm genehm ist. Trump sollte den Kerl im Auge behalten.
DER soll also jetzt für Meinungsfreiheit sein?? Im Ernst?
Der Drehhofer aus den USA! Dass ich nicht lache!
Aber, liebe Meta-Facebook-Mitglieder: Glaubt diesen Mist ruhig. Ich kann jedenfalls ruhig schafen. Ich gebe nicht viel auf solche Menschen.
Das Lob für den Herrn Zuckerberg geht mir zu weit. Mir kommt er eher als windiger Charakter, als klassischer Opportunist vor. Vorher war Biden, jetzt ist Trump. Und Zuckerberg immer vorne mit dabei.
Vermutlich dringt das, was sich seit mind. 3 Jahren in Deutschland abspielt, auf internationaler Ebene durch. Der Weg hin zur Meinungsdiktatur kommt- leider schon wieder- von Deutschland und löst gerade offenbar einen Erdrutsch aus. D-Land hat erneut den Bogen überspannt. Und tatsächlich, genug ist genug. Gut so, denn was sich in diesem Land abspielt, lässt sich unter keinen Deckel mehr halten, und sollte anderen Ländern zur Mahnung gereichen. „Wehret den Anfängen“ ist jetzt.
Startet Habeck noch eine Petition?
Apollo könnte auch endlich die Zensur stoppen,
Das Lügenportal Correctiv sollte zerschlagen und die Faktenverdreher zur Rechenschaft gezogen werden! Das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich werde schon mal den Sekt kalt stellen.
Oha.
Da wird Fääser aber mal heftigst in die Tischplatte beißen.
Rrrahahaha!
to little! to late!
Bezeichnend, dass man davon nur wieder in den Alternativmedien liest.
Größten Respekt vor Zuckerberg, er hat aus seinen Fehlern gelernt und das Spiel der Sozialisten durchschaut. Die USA ist mit all ihren Fehlern für mich immer noch die stärkste Demokratie auf dieser Welt.
Zuckerberg war, ist und wird immer ein Opportnunist sein.
Aktuell nutzt er nur wieder mal den „Wind of Change“, vermutlich auch weil seine Plattform zunehmend an Zustimmung verliert, was unter anderem auch der stark linken Zensur zu verdanken sein dürfte.
Ebenfalls kein dummer Schachzug um sich wieder ins Spiel zu bringen und seine Plattform wieder ins Rennen zu bringen,
Wie geil ist das denn?
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/das-zensurmonster-mark-zuckerberg-will-zur-meinungsfreiheit-zurueck
„Mark Zuckerberg hat mit seinen Löschorgien und Diffamierungen gegen die Gelöschten so viel Leid über die Menschen gebracht, wie kein Unternehmen vor ihm. Niemand hat die Systeme der Unterdrückung der Meinungsfreiheit weiter vorangetrieben als Mark Zuckerberg aus White Plains, New York.
Der Milliardär als Menschenfeind.“
Wallasch trifft.
Tja in der US-Verfassung ist Redefreiheit garantiert.
Bei unserem Grundgesetz wird fast jeder Artikel relativiert bis ausser Kraft gesetzt!
::
Art 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue
zur Verfassung
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf
:
Absatz 2 relativiert/zerstört die Rede/Meinungsfreiheit.
Und diese Relativierungen ziehen sich durch das ganze Grundgesetz!
Bis heute war ich ein Lügner und Betrüger. Doch ich gelobe Besserung, schaut her, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch.
Hmm .. ob man so einem glauben kann?
Zuckerberg opferte seine Glaubwürdigkeit und beeinflusste maßgeblich die Wahlen im Jahr 2020, durch Vorenthaltung relevanter Informationen ( genau wie Jack Dorsey mit twitter ) z. B. betr. des Laptops from Hell, Burisma, „the big guy“, Scamdemic, Gen-Therapie, angeblicher russischer Einmischung in die US Wahl, ………Und er würde es wieder tun.