Chaos in Frankreich: Warum jetzt eine neue Euro-Krise droht
Frankreich steht vor einem finanzpolitischen Fiasko. Die Staatsverschuldung ist völlig ausgeufert. Die Zinszahlungen die an die Gläubiger geleistet werden steigen drastisch. Offen ist inzwischen die Rede von einem möglichen Staatsbankrott. Europa droht die Neuauflage der Euro-Krise.

Frankreich steht vor einem politischen und wirtschaftlichen Fiasko. Nachdem Präsident Emmanuel Macron im Sommer Neuwahlen angekündigt hat, taumelt das Land von Krise zu Krise. Vor allem der desaströs aufgestellte Haushalt bereitet den Franzosen Probleme. Premierminister Michel Barnier wollte Frankreich aus diesem Grund ein rigoroses Sparprogramm auferlegen.
Im Parlament scheiterte er mit diesem Vorhaben jedoch kläglich. Die Retourkutsche erhielt er am Mittwochabend. Eine Mehrheit aus Linken und Rechten sprach ein Misstrauensvotum gegen Barnier aus und zwang ihn zum Rücktritt. Frankreich steht nun erneut ohne Regierung da. Auch am Stuhl von Präsident Macron wird aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Lage zunehmend gesägt. Er schließt einen Rücktritt jedoch aus.
Dabei sehen die Wirtschaftsdaten aus Frankreich auf den ersten Blick wesentlich besser aus als die Deutschlands. Während Deutschland in der Rezession steckt, kann Frankreich ein Wachstum von immerhin rund einem Prozent verzeichnen. Auch im kommenden Jahr dürfte die französische Wirtschaft stärker zulegen als die deutsche. Selbst die Arbeitslosenquote bewegt sich für französische Verhältnisse mit 7,2 Prozent in einem akzeptablen Rahmen. Doch der Schein trügt.
Der S&P-Einkaufsmanagerindex im November zeigt, dass auch über Frankreichs Wirtschaft dunkle Wolken aufziehen. Die Unternehmen berichten von einer anhaltenden Nachfrageflaute. Der Automobilsektor erreicht trotz einer leichten Erholung der Neuzulassungen noch nicht das Niveau von 2019. In einer noch schärferen Krise steckt die Baubranche, und die Firmenpleiten häufen sich. Der Auftragseingang in der Industrie hat den niedrigsten Stand seit der Corona-Pandemie erreicht.
Werbung
In Frankreich treffen diese wirtschaftlichen Probleme jedoch auf einen völlig außer Rand und Band geratenen Staatshaushalt. Der französische Staat steht mit 3,2 Billionen Euro tief in der Kreide. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt beträgt die Verschuldung in Frankreich rund 110 Prozent. In der gesamten Euro-Zone ist die Verschuldungsquote lediglich in Italien und Griechenland höher. Die Abkehr von der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) setzt den französischen Staatshaushalt massiv unter Druck. Rund 40 Milliarden Euro muss Frankreich in diesem Jahr nur für die Zahlung der Zinsen aufbringen.
Lesen Sie auch:
Kanton Jura
Wegen Belästigung durch Ausländer: Freibad erlaubt Zutritt nur noch für Schweizer
Die Schweizer Gemeinde Porrentruy hat eine Zugangsbeschränkung erlassen: Nur noch Schweizer und Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz dürfen das Freibad betreten. In der Vergangenheit hatten Franzosen junge Frauen im Freibad belästigt.Paris
Musikfestival wird zum Gewaltexzess: Über 100 Spritzenattacken auf Frauen, 1500 Verletzte, mehrere Messerstechereien
Bei einem Musikfestival in Frankreich ist es zu enormer Gewalt gekommen. So wurden knapp 1500 Verletzte gemeldet, über 100 Frauen wurden mit Spritzen verletzt, weiterhin soll es zu mehreren Messerattacken gekommen sein.Das entspricht in etwa den Ausgaben, die Frankreich für seine gesamte Verteidigung aufbringt. Im Jahr 2023 erreichte das Haushaltsdefizit bereits 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr 2024 wird ein noch höheres Defizit von über sechs Prozent des BIP und 2025 sogar ein Defizit von bis zu sieben Prozent erwartet. Sollte sich die Wirtschaft schlechter als erwartet entwickeln, weil etwa der kommende US-Präsident Donald Trump mit seinen angekündigten Zollmaßnahmen gegen die Europäer Ernst macht, sieht die Lage in Frankreich noch wesentlich prekärer aus.
Die für die Euro-Länder vorgeschriebenen Maastricht-Kriterien verfehlt Frankreich grandios. Die Regeln sehen vor, dass ein Mitgliedsstaat ein jährliches Haushaltsdefizit von höchstens 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufweisen darf. Zudem wurde eine Obergrenze für die Gesamtverschuldung festgelegt, die 60 Prozent des BIP nicht überschreiten soll.
Werbung
An den Finanzmärkten treibt das fiskalische Gebaren der Franzosen den Anlegern entsprechend die Sorgenfalten auf die Stirn. Die hohe Staatsverschuldung in Kombination mit dem heftigen Defizit lassen Marktteilnehmer zunehmend an der Zahlungsfähigkeit Frankreichs zweifeln. Die Rating-Agentur Fitch hat bereits gehandelt und den Daumen für französische Staatsanleihen gesenkt. Die Bewertung des Landes als Schuldner wurde von „stabil“ auf „negativ“ angepasst.
„Die für dieses Jahr prognostizierte fiskalische Fehlentwicklung bringt Frankreich in eine schlechtere fiskalische Ausgangsposition, und wir erwarten nun größere fiskalische Defizite, die zu einem steilen Anstieg der Staatsverschuldung in Richtung 118,5 Prozent des BIP bis 2028 führen werden“, hieß es in einer Mitteilung der Agentur. Die Zinszahlungen, die Frankreich an private und institutionelle Akteure zahlen muss, steigen entsprechend sprunghaft an.
Bei gleichem – von der EZB vorgegebenem – Zinsniveau muss Frankreich gegenüber Deutschland Risikoaufschläge von etwa 90 Basispunkten (0,9 Prozent) zahlen. Vor allem seit November steigen die Zinskosten, die Frankreich gegenüber Deutschland tragen muss, deutlich an. Die wahre Dramatik verdeutlicht jedoch auch diese Zahl noch nicht. Aufgrund des politischen Chaos in Deutschland ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe seit Anfang Oktober um fast 0,4 Prozentpunkte auf 2,36 Prozent gestiegen. Entsprechende Anleihen des französischen Staates werden inzwischen mit deutlich über drei Prozent verzinst.
Werbung
Frankreich könnte nun schnell in eine undurchbrechbare Abwärtsspirale geraten: Schwindendes Marktvertrauen und sinkende Kreditwürdigkeit treiben die Zinskosten in die Höhe, was das Haushaltsdefizit vergrößert. Dies wiederum würde das Vertrauen der Investoren weiter untergraben, die Zweifel an Frankreichs Zahlungsfähigkeit verstärken und die Zinskosten weiter antreiben.
In Frankreich ist man sich dieser Dynamik durchaus bewusst. Offen ist schon die Rede von einem drohenden Staatsbankrott. Auszuschließen ist dieses Szenario nicht mehr. Frankreich erlebte 1788, am Vorabend der Französischen Revolution, einen Staatsbankrott bei einer Verschuldungsquote von „nur“ 64 Prozent des Sozialprodukts und Zinszahlungen von 12 Prozent. Seitdem mögen zwei Jahrhunderte vergangen sein, die grundlegenden wirtschaftlichen Mechanismen sind jedoch unverändert.
Dass Frankreich aus eigener Kraft seinen desaströsen Haushalt wieder in ruhige Gewässer bringen kann, gilt indes als immer unwahrscheinlicher. Eine wie auch immer geartete Regierung müsste die Franzosen hierfür ein hartes Sparprogramm diktieren. Parlamentarische Mehrheiten dürften bei aktuellen politischen Verhältnissen jedoch kaum erreichbar sein. Aus diesem Grund werden schon jetzt Rufe nach der EZB laut.
Werbung
Auf Grundlage des sogenannten Transmission Protection Instruments (TPI) ist es der EZB grundsätzlich erlaubt, Staatsanleihen in beliebiger Menge aufzukaufen. Zu den Voraussetzungen gehört, dass das betroffene Land einer nicht gerechtfertigten Verschlechterung seiner Finanzierungsbedingungen ausgesetzt ist. Zudem muss der Renditeanstieg bei Staatsanleihen in ungeordneter Weise erfolgen, wie etwa bei starken Marktverwerfungen.
Noch gilt der Einsatz des TPI als unwahrscheinlich. So erklärten Analysten der Barclays Bank: „Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die EZB das Transmission Protection Instrument aktiviert und französische Staatsanleihen kauft, wenn der Haushalt abgelehnt wird und die Regierung zusammenbricht.“ Spitzt sich die finanzielle Lage in Frankreich zu, könnte sich der Wind jedoch schnell drehen. Übergeordnet könnte auch das Thema Euro-Bonds, also die gemeinschaftliche Verschuldung und Haftung der Euro-Länder, wieder an Fahrt aufnehmen. Präsident Macron treibt die Debatte hierum schon seit Beginn seiner Präsidentschaft 2017 mit zunehmender Vehemenz an.
Für die gesamte Eurozone ist das finanzpolitische Treiben der Franzosen hochgefährlich. Sollte Frankreich es nicht schaffen, seinen Haushalt einigermaßen tragfähig aufzustellen, könnte eine erneute Eurokrise drohen. Anders als 2010 macht dieses Mal jedoch nicht ein kleines Land am Rande Europas Sorgen, sondern das in der EU flächenmäßig größte Land mit der zweitbedeutendsten Wirtschaft. Die Folgen für ganz Europa wären unabsehbar.




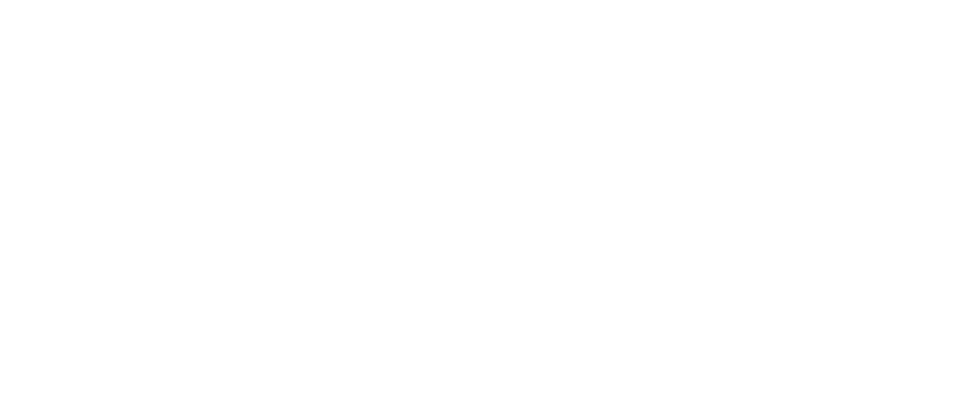
Mein Tipp. So schnell wie möglich raus aus der EU. Seid schlau wählt blau.
Die Euro-Krise, letzlich nur die zwangsläufigen Probleme, die bei einer Gemeinschaftswährung in einem nicht-optimalen Währungsraum auftreten, war nie weg, nur mit Geld zukünftiger Generationen zugeschüttet und von anderen aktuellen Krisen überlagert…
Nun, schon vor Jahren sagte ich, daß die sich abzeichnende Inflation gewollt ist, damit sich die Staaten der Euro-Zone ihre Verschuldung zu Lasten der Sparsamen und Fleißigen „weginflationieren“ können.
Und genau das wird jetzt wieder passieren, weil ein französischer Staatsbankrott das Ende des von Anfang an unverantwortlich riskanten Euro-Experiments bedeuten würde.
In Deutschland kann sowas nicht passieren. Wir können uns voll auf Robert verlassen. Denn „keiner kann im Sturm das Ruder so rumreißen wie Robert Haareweg. Und zugleich bei Rückenwind die Segel richtig setzen“.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dann könnte man zur EWG zurück kommen.
Habt Ihr alle in Gold investiert? Ihr glücklichen. Ihr seid auf der sicheren Seite.
Wobei man hätte sparen können: Bei diesem Olympia-Theater und nicht nur bei der einen Show!
Ach was ! – da machen wir einen schönen Schuldenschnitt.
Oder wir übernehmen Frankreichs Schulden an Deutschland einfach selbst.
Wie man es auch dreht und wendet, es läuft im Endeffekt sowieso immer auf’s selbe raus. Wir sind der Arsch vom Dienst. Jede Wette !!
Dem Euro droht keine Krise, der Euro ist selber eine Krise.
Hoffentlich kommt die Krise möglichst bald, dass endlich mit dem Neuaufbau der Nationalstaaten und eines europäischen Wirtschaftsraums begonnen werden kann. Dieses schleichende Versinken im Sumpf ist einfach fad und wird sich mit den Protagonisten sich nicht ändern lassen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Das eine Prozent Wirtschaftswachstum haben sich die Franzosen wahrscheinlich mit dem staatlichen Haushaltsdefizit erkauft. In den USA ist das noch schlimmer: für 1 Dollar Wirtschaftswachstum nimmt die US Regierung 2,5 Dollar neue Schulden auf. Da lob ich mir unsere Schuldenbremse das wir so einen Quatsch nicht mit machen.
Ansonsten: das ist eine französische Haushaltskrise, ich verstehe nicht, wie die darauf kommen, das nationale Probleme von Brüssel aus gelöst&bezahlt werden.
Wenn doch, wird der Euro zur neue Lira und Franc, eine Konfetti Währung.
Investieren Sie entsprechend.
Wunderbar! Es lauft alles nach Plan. Krisen sind immer toll, da kann man den Bürgern Sachen auf’s Auge drücken, die sie in normalen Zeiten nie akzeptieren würden. In den oberen Etagen freut man sich schon, auch wenn man nach außen eine Pseudobesorgnis vorgibt.
raus aus der eu, bevor frankreich, italien und eventuell spanien kippen…ohne uns als zahlmeister wäre die eu geschichte. oder wir warten, bis wir als zahler ausfallen oder frankreich baünkrott ist. so oder so, die eu hat keine zukunftg und das ist eine gute nachricht. und so oder so, es wird richtig teuer, die target summen sind nur die kirsche auf der torte…
Nun, das Problem „im Hintergrund“ ist ja, daß nach der Republik wieder ein neues Prinzipat Gestalt annimmt:
Auf die Diktaturen Sullas und Caesars und die Bürgerkriege folgte das Prinzipat des Augustus, das sich als „Kaisertum“ etablierte, indem es sich auf die „tribunizische Gewalt“ stützte. Das heißt, man berief sich darauf, nur im Namen und für die Interessen der Bürger zu handeln.
Das neue Prinzipat in Gestalt der EU und ihrer demokratisch nicht legitimierten „Kommission“ zeichnet sich bereits am Horizont ab. Sie versuchen, Macht zu konzentrieren und auszuüben unter dem Vorwand, dies im Interesse der EU-Bürger zu tun. Dabei werden diese durch genau dieses Bestreben zunehmend zu Untertanen und Befehlsempfängern der europäischen Feudalelite eines neuen Prinzipats degradiert.
Nein, doch, ohhhh!
Nicht vergessen: Macron war ja nur der Verlegenheitskandidat, auf den sich all jene halbwegs einigen konnten, die gegen Marin LePen waren. Höchste Zeit, dass er geht.
Dass Frankreich bereits 2003 abgewirtschaftet hatte, kann man bei Nicolas Bavarez (2003). „La France qui tombe“ nachlesen.
Das zahlt der deutsche Steuerzahler, keine Sorge! Hauptsache, Frankreich kann weiterwurschteln!
Tango korrupti läuft an.
Mir ist immer noch ein Rätsel, mit wessen Hilfe und aus welchen Gründen der Macron Präsident werden konnte.
Was den Deutschen fehlt: Die Franzosen gehen wegen allem, was vernünftig wäre, ihnen aber nicht gefällt, auf die Straße bzw. Kreisverkehre.
Sie haben in Person des Mélenchon einen furchterregenden Agitator.
Reformen kann sich jeder Politiker in Frankreich abschminken.
Die Volkswirtschaft verliert seit 30 Jahren ihren produktiven Zweig, beschleunigt durch die Einheitswährung (warum teuer selbst herstellen, wenn man es billiger in D. kaufen kann?)
Ausländ. Konzerne ziehen sich aus Frankreich zurück (siehe als Détail den Brief von dem Goodyear-Chef Maurice Taylor an den Minister Montebourg (französischer Habeck).)
Aus Angst vor Aufständen werden ansonsten Arbeitslose in staatlichen Betrieben und der Verwaltung beschäftigt oder sonstwie durchgefüttert.
Wahrscheinlich war Giscard der letzte, der von Wirtschaft etwas verstand.
Und er vertrug sich gut mit Helmut Schmidt.
Gibt es eine Liste mit den größten Gläubigern Frankreichs?!
„Das ist wie Versailles, nur ohne Krieg!“ (François Mitterrand über das Einverständnis Deutschlands die DM aufzugeben)
„….die Frankreich für seine gesamte Verteidigung aufbringt“ ! Gegen wen verteidigt sich Frankreich denn? Der Feind sitzt in den Banlieue und wählt linksextreme Kleptokraten. Und mit der Fremdenlegion begeht Frankreich weltweiten Terror und versucht sich in Afrika auf postkollonialistische Weise das Uran zu sichern das die Afrikaner auf einem freien Weltmarkt zum x-fachen Preis verkaufen könnten. Dazu noch die Unterstützung des Bandera-Regimes. Ich sehe da keine „Verteidigungsausgaben“.
Früher musste der Franzose mit Waffengeklirr östlich des Rheins und südlich des Mittelmeers ziehen, um der Grande Nation Ruhm und Reichtum zu rauben, heute reicht einen Brief nach Berlin zu senden, dass Erbfreund Michel das freiwillig auf seine Schlafmütze nimmt.
Macron denkt nicht dran Zurückzutreten, erst muß Frankreich zerstört werden!, ist wie in Deutschland, die Linksgrünen Parteien machen einfach immer weiter, egal was der Wähler wählt, daß Land muss erst zerstört werden. Merz wird mit den Grünen Deutschland den Rest geben wie Macron Frankreich!!
Es wird höchste Zeit, das die EU Kloake kastriert wird…zurück zur EWG und gut ist..
Und das ganze Politiker und Beamten Gesocks ab in die Arbeitslosigkeit…