Digitalgipfel der Bundesregierung: Hoffnungslos abgehängt und ohne Esprit
Amerika und China hängen die europäische Digitalwirtschaft um Meilen ab. In Berlin findet dazu ein EU-Gipfel statt – doch vom erstickenden Regulierungswahn will Brüssel nicht abrücken. Stattdessen: Mehr Staat.

Es war wieder Gipfelzeit in Berlin. Nach den Krisentreffen mit der Automobil- und Stahlwirtschaft richteten sich die Blicke am Dienstag in Berlin auf das nächste Sorgenkind: die Digitalwirtschaft. Diese wurde vom EU-Regulierer bislang buchstäblich erstickt.
Großer Bahnhof auf dem Berliner EUREF-Campus: Rund 900 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus ganz Europa reisten am Dienstag zum Digitalgipfel in die Bundeshauptstadt. Unter den prominenten Rednern: Bundeskanzler Friedrich Merz und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron, denen in diesen Tagen innenpolitisch eine steife Brise entgegenbläst.
Werbung
EU-Europa ist nun auch auf politischer Ebene ganz offiziell im Krisenmodus angelangt. Die schiere Zahl der Wirtschaftsgipfel ist Ausdruck dessen und lässt nichts Gutes für die kommenden Jahre ahnen. Und mit Blick auf die Digitalwirtschaft, die die nächste große wirtschaftliche Revolution eingeleitet hat, muss man konstatieren: Der Panikmodus in Brüssel, Paris und Berlin hat seine Berechtigung.
Denn die technologische Lücke, die zwischen der Euro-Ökonomie und der Konkurrenz aus den USA und China aufgerissen ist, scheint derzeit unüberbrückbar. Von Revolution keine Spur.
Werbung
Lebloser Kapitalmarkt
Ein Blick auf das nackte Zahlenwerk genügt, um sich einen präzisen Eindruck vom technologischen Hiatus zu verschaffen: In den USA fließen in diesem Jahr über 340 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz, nachdem bereits 2024 Kapital in Höhe von 244 Milliarden US-Dollar bewegt wurde. In China mobilisiert die Privatwirtschaft immerhin etwa 100 Milliarden Dollar, um ihre digitalen Prozesse aufzurüsten.
Lesen Sie auch:
Klimapolitik mit dem Vorschlaghammer: Mautbefreiung von E-Lkw fördert ein Geistersegment
Die Bundesregierung hat die Befreiung elektrischer Lkw von der Mautpflicht verlängert – eine milliardenschwere Subvention für ein unrentables, kaum existentes Marktsegment. Ideologie soll gegen die Kräfte des Marktes durchgesetzt werden.Stellantis
Opel, Peugeot und Citroën setzen wieder auf Dieselmotoren
Der Autokonzern Stellantis will sich nicht nur von Elektroautos abwenden, sondern auch wieder mehr Dieselwagen herstellen. Die Abschreibung auf das lahmende Elektroauto-Geschäfte soll 22 Milliarden Euro betragen.Die EU hingegen kommt – selbst wenn man Großbritannien großzügig in die Kalkulation aufnimmt – auf gerade einmal rund 25 Milliarden Euro. Ein kaum erwähnenswerter Anteil im globalen Maßstab.
Allein Amazon investiert mit etwa 118 Milliarden US-Dollar beinahe fünfmal so viel Kapital wie die gesamte EU-Wirtschaft, die ihren geringen Anteil im Übrigen nur durch eine Finanzspritze der öffentlichen Hand von etwa 50 Prozent aufbringen kann. Das alles wirkt politisch beschämend, ökonomisch desaströs
Werbung
Saftloses Gipfeltreffen
Das Dilemma der europäischen Politik schälte sich auch aus den Redebeiträgen in Berlin heraus. Man hat den Regulierungsrahmen von Beginn an viel zu eng gefasst, den eigenen Innovationsprozess systematisch erstickt und ist nun in der digitalen Wirtschaft abhängig – vor allem von amerikanischen Konzernen wie Amazon, Google oder Microsoft. Software von SAP? Kommt nicht selten aus den USA!
Eine der zentralen Forderungen des Gipfels lautete daher, sich unabhängiger von dieser machtvollen Konkurrenz aus Übersee zu machen.Aus diesem Grunde kündigte die Europäische Kommission am Gipfeltag an, in den kommenden zwölf Monaten zu überprüfen, inwieweit schärfere Regulierung die vermeintlich wettbewerbswidrigen Praktiken von Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure und Amazon Web Services einhegen kann. Ein zähes Ringen steht bevor, um sich mit der amerikanischen Regierung auseinanderzusetzen, die mit aller Macht Gegendruck aufbauen dürfte.
Bundeskanzler Merz und Digitalminister Wildberger wiederholten derweil in Berlin die Forderung nach europäischer Souveränität im digitalen Raum und warnten vor der Abhängigkeit der Wirtschaft von amerikanischer Software. Es gehe um die aktive Mitgestaltung der digitalen Zukunft, so Merz´ Mantra, ein Aufholprozess solle angestoßen werden, die Lücke zur Konkurrenz zu schließen.
Werbung
Der Staat soll es richten
Daraus leiten europäische Politiker eine altbekannte Folgerung ab: öffentliche Förderung. Sie macht bereits jetzt rund 40 Prozent des gesamten KI-Volumens in Europa aus und soll künftig verstärkt auf die Ausbildung und Bindung europäischer IT-Talente ausgerichtet werden.
Sie soll außerdem dem Aufbau einer eigenständigen digitalen Infrastruktur bewirken, insbesondere im Cloud-Bereich sowie der Cybersicherheit, einer weiteren Achillesferse der europäischen Wirtschaft.
Der Fachverband der Digitalwirtschaft, Bitkom, drängt auf eine umfassende Vereinfachung der EU-Digitalgesetze und drastische Reduktion der Berichtspflichten. Die DSGVO war von Beginn an ein teurer und unsinniger Schlag ins Wasser, ähnlich wie andere Elemente der Überregulierung Brüssels. AI Act und Data Act – alles gehört auf den Prüfstand, entschlackt oder vollständig abgewickelt.
Werbung
Digitalsteuer als Ultima ratio?
In ihrem derzeitigen Zustand ist die Digitalwirtschaft der EU schlicht nicht in der Lage, ihre Leistungen zu skalieren oder im Innovationsprozess mit der internationalen Konkurrenz Schritt zu halten. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Einführung einer Digitalsteuer auf die Werbeeinnahmen der globalen Player, vor allem der US-Konzerne. Zuletzt wurde sie von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar polemisch in die Debatte eingeworfen.
Nur: Was genau soll dies am Befund ändern? In Europa blockiert der Staat den Innovationsprozess. Zu viel Kapital fließt in Europa durch die Kanäle der öffentlichen Hand, um überhaupt einen funktionsfähigen Venture-Capital-Markt entstehen zu lassen, der diese innovativen Produkte mit der notwendigen finanziellen Firepower ausstatten könnte.
Den Gipfelteilnehmern dürfte angesichts der wirtschaftlichen Lage klar gewesen sein: Wir stehen in der EU vor einem Trade-off. Maximaler Datenschutz hemmt das Branchenwachstum. Und die EU wird sich bewegen müssen, in Richtung Liberalisierung und Rückverlagerung des Datenschutzes auf die Nutzer.
Werbung
Am Mittwoch steht in Brüssel dieser Aspekt im Mittelpunkt der Parlamentsdebatte. Die Datenschutzregeln sollen gelockert werden, um der Digitalwirtschaft Raum zum Wachstum zu geben.
Im Prinzip herrschte in dieser Frage Einigkeit zwischen Bundeskanzler Merz, Emmanuel Macron und dem europäischen Regulierer.
Energieproblem und Innovationskultur
Die Ökonomie der Zukunft ist datengetrieben und angesichts ihres enormen Energiebedarfs angewiesen auf eine stabile Energieinfrastruktur und auf hochkompetitive Start-ups, die sich wie ein Gürtel um die technologischen Zentren ihrer Standorte legen. Nichts davon existiert derzeit in Deutschland. Das Ergebnis: Internationale Investoren haben schlicht kein Interesse daran, den Standort überhaupt in ihre Kalkulation aufzunehmen.
Blickt man auf die schiere Größe des europäischen Binnenmarktes, die nach wie vor vorhandene Kapitalkraft und die robuste akademische Struktur, dann grenzt es an eine politische Großtat, den Sektor der Digitalwirtschaft so vollständig erstickt zu haben.
In Brüssel hat man das Regulierungswerk errichtet, lange bevor überhaupt eine nennenswerte Digitalwirtschaft existierte. Geht es darum, den freien Markt einzuhegen und zu manipulieren, agiert Brüssel erstaunlich effizient – und maximal destruktiv.
Rückzug der Kommission
Wer aus dieser regulatorischen Falle ausbrechen und digitales Unternehmertum stimulieren will, müsste mit dieser schlechten Praxis radikal brechen: mit Regeln wie dem AI Act oder der DSGVO.
Es müsste ein Ende finden mit den fortdauernden Eingriffen durch den Digital Services Act (DSA) und den Digital Markets Act (DMA), die den digitalen Markt Europas bis ins Detail regulieren und so die unternehmerische Freiheit einschränken.
Allerdings zeigte der Gipfel in der Tendenz keinerlei Einsicht in die selbstgeschaffene Problemlage. Gerade Brüssel versteht die wachsende Kritik am DSA und DMA als schweren Angriff auf seine Machtbasis. Die Digitalregulierung muss, ähnlich wie die Klimapolitik, im Kontext des ideologischen Umbaus der Euro-Ökonomie betrachtet werden. Die Fäden der Macht laufen in Brüssel zusammen, hier findet sich die politische Steuerungszentrale dieses fatalen Prozesses. Doch der Druck auf den Regulierer wächst mit der sich vertiefenden Rezession.
Marktzugangshürden müssten fallen, Unternehmertum sollte freier agieren können, die fiskalischen Lasten sinken – und selbstverständlich müsste sich der Staat als überdominanter Akteur am Kapitalmarkt zurückziehen.
Den Gordischen Knoten im digitalen Raum mit Hilfe radikaler Liberalisierung zu durchschlagen und autonome europäische Ökosysteme wachsen zu lassen, klingt im Berliner Gipfel- und Regulierungssound wie eine Fabel.
Selten prallten die politischen Philosophien und ökonomischen Paradigmen der USA und Europas derart brachial aufeinander wie gegenwärtig im Feld der Digitalwirtschaft. Der Streit über Brüssels Zensurpolitik, den Digital Services Act und die geplante Chatkontrolle hat zu veritablen atmosphärischen Störungen geführt, die sich seit der Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar nur weiter aufgeschaukelt haben. Vance übte seinerzeit scharfe Kritik an der europäischen Zensurpraxis und dem Angriff auf die Meinungsfreiheit.
Der Kampf um bürgerliche Rechte, Meinungsfreiheit und das Recht auf Eigentum tobt sich unverkennbar im digitalen Raum aus. Dort heißt es nun: Freiheit gegen Überwachung, Selbstverantwortung gegen den Nannystaat – USA gegen die EU?
Im Groben könnte man das so interpretieren. Doch auch die USA werden auf mittlere Sicht die Frage beantworten müssen, wie sie es mit der Marktmacht ihrer eigenen Oligopole im digitalen Raum halten und ob es gelingen kann, den Marktzugang für neue Wettbewerber offen zu halten oder ob auch in Washington die Lobbyarbeit ähnlich wie in Brüssel dazu führen wird, dass am Ende ein korporatistischer Geist Amazon und Co. vor lästiger Konkurrenz abschirmt.
Digitaler Risikoraum
Für den europäischen Regulator stellt der digitale Raum vor allem eines dar: Ein narratives Risiko, ein entgrenzter, nur schwer zu disziplinierender öffentlicher Raum, der oppositionelle Tendenzen eher befeuert als dämpft.
Die jüngsten Angriffe insbesondere der deutschen Politik auf US-Plattformen wie X und Meta sind Ausdruck eines wachsenden Problembewusstseins – und des fortschreitenden Kontrollverlusts in jenen Konfliktfeldern, die für die politische und ideologische Statik in der EU entscheidend sind: die Klimapolitik, der Ukraine-Konflikt und die sich vertiefende ökonomische Krise, die in staatsnahen Medien nur gedämpft, oft geradezu unterbelichtet, vor sich hin schwelt.
Stets schwebt die Gefahr über der Politik, das sich eine kritische Opposition im Opaken formiert, dezentral, polemisch und akzentuiert, ohne den Filter öffentlich-rechtlicher Medienpädagogik.
Im Hintergrund der Debatte um die digitale Zukunft der Eurozonenwirtschaft schimmert das Gespenst des digitalen Euro und der mit ihm verbundenen Frage der individuellen Souveränität vor allem im digitalen Raum durch.
Allein der Versuch, diese Technologie als eine Art zentralisierter staatlicher Dominanzgeste in die Geld- und Kapitalmärkte einzuflechten, zeigt, dass man in Brüssel nicht erkannt hat, dass es sich bei der digitalen Technologie um Fragen des dezentralen Wettbewerbs handelt und diese nur unter minimaler staatlicher Regulierung gedeihen kann.
Mit dem Genius Act und der Integration von US Stablecoins in das Bankensystem, das quasi einen alternativen Geldmarkt gebiert, verlagert der amerikanische Gesetzgeber Fragen der Geldschöpfung durch den Kreditprozess tiefer in den Verantwortungsbereich der Privatwirtschaft.
Europäischer Anachronismus
Alles läuft auf die synchronisierte Verschmelzung von dezentraler Geldschöpfung und technologischer Anwendung digitaler Applikationen wie der künstlichen Intelligenz hinaus, weshalb der Versuch der Europäischen Union, beide Elemente der Digitalwirtschaft zu zentralisieren und über scharfe Regulierung zu steuern, scheitern muss.
Der Digitalgipfel bestätigte die Befürchtung: Europäische Politik hat sich intellektuell und bürokratiepraktisch in einem ökonomischen Verständnis verfangen, in dem öffentliche Förderung, Regulierung bis ins letzte Detail, tarifgebundene Industriearbeitsnormen und ein schroff zensierter öffentlicher Diskursraum das ideologische Leitbild formen. Das kann und das wird nicht gut gehen, wenn der technologische Fortschritt in Richtung Freiheit drängt.

 Freund werden
Freund werden



 Freund von Apollo News werden
Freund von Apollo News werden 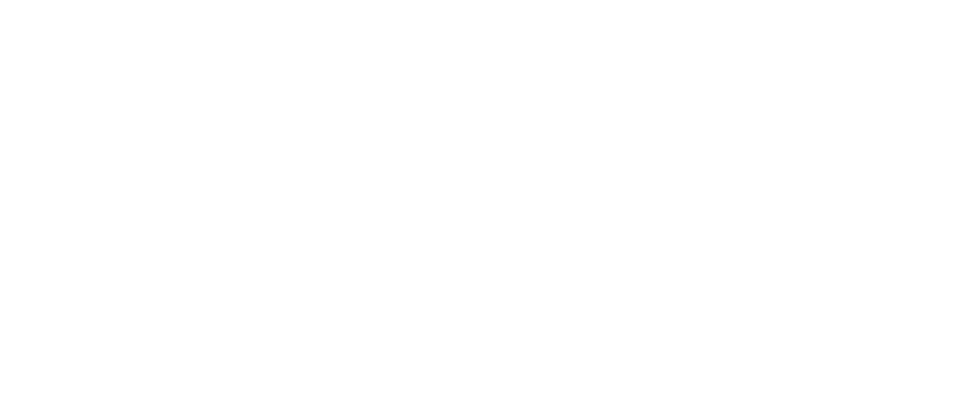
Da haben sich die „Blinden“ getroffen, um über das Farbfernsehen zu diskutieren. Liebe Freunde, der Zug ist abgefahren!
„Amerika und China hängen die europäische Digitalwirtschaft um Meilen ab“
Technologie,ist doch auch seit Jahren, total überbewertet!
Geht doch,bei den Rentier-Nomaden,in der Tundra auch.
Immer so larmoyant!
Na ja.
Zur Chatkontrolle reicht’s doch noch.
Abwarten. Bin mir nicht so sicher, dass die das hinkriegen. Ich denke da „Corona-Äpp“ & Co.
Israel hat mehr tech Einhörner , als ganz Europe zusammen. Zehn Millionen Israelis schaffen in der IT Branche mehr als 300 Millionen Europäer.
Obwohl dieses Steuergeld uns gehört und dort in der Geldwaschmaschine versickert.
Zuviel Wodka heute?
Wir können mittlerweile nicht mehr in der oberen Liga mitspielen. Anstatt zu trainieren und ein Umfeld zu schaffen, indem man aufholt, versuchen wir das Spiel kaputtzumachen. So kann man nur verlieren.
In Argentinien wird so viel in KI investiert, wie in der ganzen EU – 25 Milliarden Dollar. Für die AI-Anwendungen wurde bereits ein eigener SMR konzipiert.
„Mama, was war die EU?“
„Das kann und das wird nicht gut gehen, wenn der technologische Fortschritt in Richtung Freiheit drängt.“ … kurze Frage Herr Kolbe, fehlt da das „nicht“ im zweiten Teil ?
Wenn ja, ein Elemtarer Satz mit Bedeutung 👍
Mutmassend könnte man sagen, im Würgegriff der Schlange.
Es fehlt das kreative Mindset, das fast völlig durch Bürokratie und Überregulierung abgewürgt wird. EU-Brüssel wird für die europäischen Staaten wirklich zum Damoklesschwert für alle Bereich der Zukunft. Und die Marktmacht von Repression und Gängelung ist sehr begrenzt.
Es scheint fast so als hätte ganz Europa die digitalen Sachen bewusst oder unbewusst völlig verpennt. Jetzt, wo die multipolare Entwicklung der Welt immer deutlicher wird freuen wir uns in allen MSM Medien bis zur Tagesschau darüber, das die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) elf Milliarden Euro in ein Rechenzentrum investiert und wir dann einen Teil unserer Daten selbst verwalten können und dafür keinen Akteur aus den Ausland brauchen. Eigentlich unglaublich alles.
Nicht „verpennt“. Das ist Weitsicht. Digitalisierung ist gefährlich und wird bewusst verhindert. Die einzige Möglichkeit den Fortbestand der Menschheit aufrecht zu erhalten ist, KI nicht zuzulassen! Denn KI braucht keinen Menschen und wird diesen als Gefahr für sich selbst ansehen…
Was wären wir bloß ohne Gipfel?
Vermutlich höher, schneller, weiter, gesünder und reicher 🙂 🙂 🙂
Wir machen einfach ein ‚gutes-Cloud-Gesetz‘ und schon läuft der Laden!
„Amerika und China hängen die europäische Digitalwirtschaft um Meilen ab“
Entschuldigung das ist ein Satz der aus der Zeit gefallen ist. Der gehört nach 2010.
Inzwischen hängt uns in Deutschland praktisch die gesamte Welt ab was Digitalisierung und Digitalwirtschaft angeht.
Nicht nur die zwei größten Wirtschaftsmächte. Es sind auch nicht nur Länder wie Japan, Taiwan und Singapur sondern inzwischen schon Malaysia, Vietnam, Thailand, Uruguai, Brasilien, Argentinien. Selbst innerhalb Europas sind wird mit Abstand das Schlusslicht. In Rumänien ist man weiter.
Wenn man nach China oder Japan reist trifft es einen wie ein Faustschlag: wird sind inzwischen mindestens 20 Jahre hintendran.
Die meisten Menschen in Deutschland glauben einfach immer noch, dass wir den Chinesen voraus sind. Das ist so falsch wie es nur sein kann. Wir sind schon nach unten durchgereicht worden.
Ich habe den Eindruck das es bei der Politik mehr darum geht zu verhindern das es der Mehrheit auffällt als es zu ändern.
Meine Reiseerfahrungen stützen das zu 100%. Myanmar hat gar nicht erst Glasfaser verbuddelt sondern flächendeckend Mobilfunk eingerichtet. Überall top Empfang. Im Internet bestellte Waren werden in die entlegensten Winkel geliefert. Aber hier haben Öko-Sozialisten Angst vor Verstrahlung und Klima.
Digitalisierung beschränkt sich in Deutschlands Staatsbetrieben darauf Faxpapier nachzufüllen, damit Datenübertragung und Datenschutz gesichert bleiben.
Hausgemacht hin oder her: Erinnert sich noch jemand an die europäische Cloud, die Unabhängigkeit von US-Ressourcen wie Amazon etc garantieren sollte? Der Plan fiel ad acta, weil das dafür vorgesehene Rechenzentrum im Elsass abbrannte und wenig später der französische Leiter des Projektes bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Das war einfach Pech…
Ich höre immer noch das Echo: Neuland…Neuland…Neuland… Das ist wie Tinnitus!
Jeder sollte sich mit den 30 jährigen Krieg mal auseinandersetzen. Bestes Lehrwerk zu unserer Zeit.
Ausgangslage: Deutschland war das reichste Land Europa, die Fugger bauten Bergwerke in der ganzen Welt (sogar Südamerika), die Hanse boomte und brachte gigantische Gewinne. Der Habsburger Kaiser war überschuldet und ideologisch katholisch verblendet.
Kriegsgrund: Der Kaiser wollte evangelische Bürger bestrafen und ihren Besitz beschlagnahmen. Die Freiheit der Städte sollte abgeschafft und höhere Steuern eingeführt werden. Ideologie + Geldgier
Endsituation: Nach 30 Jahren war alles Kapital vernichtet, das Land geplündert und geschändet. Das Land zerfiel für 200 Jahre in Kleinstaaten. Deutschland galt als Bordell und Kasino Europas. Industrie verschwand komplett (Die frühe Industrie im Rüstung, Minen und Buchdruck).
Wir haben den ganzen Mix wieder. Ideologie und die Gier einer Energiemafia ruinieren das Land.
Digial EU-Gipfel, Digitalminister.. wann kommt der Religionsminister
KI ist etwas, was schnell gewaltige Mengen an Energie einfordert. Es sind Rechenzentren im Bau, die ihr eigenes Atomkraftwerk benötigen werden – und in den USA und in China werden diese dann eben gebaut. Das wertvollste Unternehmen in Europa – wie Alice Weidel letztens eindrücklich darlegte – klebt hingegen Handtaschen zusammen, während China und die USA darum wetteifern, wer demnächst die gesamte Welt mit humanoiden Robotern ausstatten wird, die alles tun werden: Zu Hause Wäsche falten, am Band Sitze in Autos schrauben und im afrikanischen Busch Neurochirurgie auf Spitzenniveau abliefern. Diese Völker werden prosperieren – wir werden in der steigenden Flut der Inflation gnadenlos absaufen und erst zur Zweiten und schließlich zur Dritten Welt werden, wenn die Islamisierung abgeschlossen ist.
Die Welt sortiert sich neu und die EU ist nicht dabei. So ist das eben, wenn auf allen Entscheidungsebenen nur Versager sind.
Mehr Staat ist mehr Überwachung und das ist Scheiße.
„und die robuste akademische Struktur“. Herzlich gelacht am Morgen. Bei 200 Genderlehrstühlen und unzähligen weiteren im Bereich der Geschwätzwissenschaften? O ja, *da* haben wir „Expertise“!!!
Die Amis und Chinesen sollten einfach nichts mehr liefern, Sozialmedia maximal einschränken. Mal schau’n was dann passiert wenn der Mob auf die Straße geht weil Tikt Tok, FB etc. nicht mehr im gewohnten Maße funktioniert.
Der Autor schreibt’s zwischen den Zeilen so deutlich, dass es jedem klar werden müsste: Um dem Brüsseler Regulierungswahn zu entkommen, der ALLES stranguliert und zerstört, was in Jahrzehnten an Wirtschaftskraft aufgebaut wurde, gibt’s nur einen Weg: RAUS AUS DER EU. Und zwar pronto pronto!
Falsche Roadmap!
Richtige Roadmap: Public Media + Public Markets
prominente Redner wie Macron und Merz – bei solchen “ Koryphäen“ steht schon vorher fest, was bei rauskommt: nix Brauchares für die Bevölkerung
Dieser undurchsichtige und Geldfressende Moloch muss dringend reduziert werden . Solch eine Willkürinstitution braucht Europa nicht und muss endlich auf ein niedrigen Niveau reduziert werden . Es erstaunt nur noch , dass ausgerechnet ein Multimillionär Merz darin seine Hauptaufgabe sieht ! Es muss endlich aufhören , dass die EU unser GG einfach außer Kraft setzt und uns das Grundrecht beispielsweise auf das Bargeld nimmt und diese Scheindemokraten dieses widerspruchslos hinnehmen !!
Die AfD sollte sich wieder darauf besinnen und die EU neu denken . Das Parlament kann sofort verschwinden !! Die EU ist für mich eher eine Mafiaorganisation die die Einzelstaaten bevormundet !!
Wundert sich jemand? Im sozialistischen Berlin schreiben sie aufgrund ihrer Sachkenntnis Digitalisierung 4x mit ie.
Joe – selbst seit Jahrzehnten IT-Admin