Der ehemalige US-Präsident Donald Trump löste in Europa jüngst Panik aus, als er bei einer Wahlkampfkundgebung sagte, er würde Russland „ermutigen“, NATO-Länder anzugreifen, die säumig bei ihren Verteidigungsverpflichtungen seien. Die „plötzliche“ Angst, der große Verbündete Amerika könnte uns in Europa im Stich lassen, trieb einige bemerkenswerte Blüten. Zum Beispiel, dass etwa die grüne taz-Journalistin Ulrike Hermann im Fernsehen prompt Atomwaffen für Europa forderte. So auch die sozialdemokratische EU-Spitzenkandidatin Katharina Barley.
Europa und Deutschland machten sich schon Sorgen über die Möglichkeit einer zweiten Amtszeit von Trump – und schienen plötzlich erschreckter denn je. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte der Financial Times wenige Tage später, dass Europa einer Welt gegenüberstehe, die „rauer geworden ist“.
Aber nichts an alldem ist neu: Weder ist Trump plötzlich NATO-Kritiker geworden, noch ist er mit seiner kritischen Haltung eine Ausnahme in der Reihe der US-Präsidenten. Und die neuesten europäischen Erklärungen eines „reckonings“, einer harten und plötzlichen Erkenntnis, mehr für die eigene Sicherheit tun zu müssen, haben wir alle schonmal gehört. Angela Merkel erklärte schon 2017 bierernst in einem Bierzelt, dass wir Europäer unser Schicksal nun selbst in die Hand nehmen müssten. Da hatte sie sich gerade mit Trump getroffen, der ihr und der gesamten NATO eine ordentliche Ansage gemacht hatte – und aus Frust fast das Bündnis platzen ließ. Wichtige Männer um den Präsidenten herum verhinderten das damals.
Haarscharf, wie Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton schreibt. Für Europa hätte es ein Weckruf sein müssen – Merkel hatte die Schicksalsfrage Europas ja immerhin feierlich-nüchtern erklärt. Doch daraus folgte – nichts. Der deutlich lautere Weckruf jährte sich am 24. Februar 2024 zum zweiten mal: Der russische Eroberungskrieg gegen die Ukraine zerbrach Jahrzehnte von Sicherheitsarchitektur auf dem Kontinent. Ein knapper Schuss vor den Bug des schläfrigen Europas.
Aufgabe: Die Industrie aus dem Wachkoma holen
Doch das entscheidet sich bisher, weiterzuschlafen. Ja, NATO-Mitglieder geben jetzt mehr Geld für ihr Militär aus. Aber Europas Fähigkeit, substantielle Kräfte über mehrere Wochen im Feld aufrechtzuerhalten, bleibt gering und ist in vielen Armeen, etwa bei der Bundeswehr, de facto nicht existent. Einige NATO-Staaten fragen sich, ob ihre europäischen Partner überhaupt substanziell zu ihrer Hilfe beitragen könnten.
Nach Trumps NATO-Äußerungen sagte von der Leyen: „Wir müssen mehr ausgeben, wir müssen besser ausgeben, und wir müssen europäisch ausgeben“. Das wäre grundsätzlich nicht falsch. Aber: Europäische Beschaffungsprojekte haben in der Vergangenheit oft nicht gut funktioniert. Schuld daran ist auch Deutschland.
Die Rüstungsindustrie in Europa wurde jahrzehntelang in einer Art Wachkoma gehalten. Ihr Geschäft suchte sie oft immer mehr im Ausland. Gerade Deutschland behandelte die eigene Rüstungsbranche sehr stiefmütterlich. Politiker rümpften gerne öffentlich die Nase über Geschäfte von Firmen wie Heckler und Koch, Airbus oder Kraus-Maffei-Wegmann, profilierten sich in Wahlkämpfen mit Rhetorik gegen Waffenexporte. Man fühlte sich gut dabei, aus moralischen Überlegungen heraus immer rigidere Ausfuhrbestimmungen zu erlassen und immer weniger zu genehmigen. Das machte die Deutschen über Jahre immer mehr zum Paria des Marktes. International wusste man: Ist irgendwo auch nur eine deutsche Schraube verbaut, sind Ausfuhr und erfolgreiches Geschäft ungewiss.
Regularien und Vorgaben machen die besten Panzer unattraktiv
Wieviel Kredit das Deutschland international kostet, zeigte die Diskussion um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine im vergangenen Jahr: Wochenlang verweigerte Deutschland Polen, welches einige seiner Leoparden an die Ukraine liefern wollte, die Ausfuhrgenehmigung. Warschau war erbost – und begann prompt, sein Heil zukünftig in südkoreanischen Panzern zu suchen. Auch andere, bisher gute Abnehmer deutscher Panzer werden das registriert haben. So gut Leoparden auch sein mögen: Wenn am Panzer noch eine ganze Kette an Regularien, Vorgaben und Bestimmungen hängt, wird selbst das beste Gerät unattraktiv für die Kunden.
Das ist das Problem der deutschen Rüstungsbranche: Die für ihre Qualität weltweit geschätzten Waffenschmieden wurden Jahrzehntelang kastriert und an der kurzen Leine gehalten. Im Zweifel gingen selbst deutsche Aufträge dank des europäischen Vergaberechts an Firmen im EU-Ausland, anstatt an heimische Firmen. Etwa im Fall der Marine, wo Blohm&Voss oder ThyssenKrupp zugunsten eines niederländischen Anbieters vor einigen Jahren leer ausgingen. Der produzierte dann zwar schlechte Bruchware – die Fregatte „Baden-Württemberg“ musste nach der Jungfernfahrt erstmal wieder lange für Reparaturen ins Dock – war aber im Ausschreibungsverfahren ein paar Euro billiger.
Das ist das Ergebnis einer toxischen Mischung. Auf der einen Seite der deutsche Vulgärpazifismus, der Bundeswehr, Rüstung und Verteidigungsausgaben vom Sofa aus für generell anrüchig und irgendwie unmoralisch erklärt hat: auf der anderen Seite die bräsige Kultur in einem Ministerium, das jahrelang keine Behörde, sondern ein Unternehmen sein sollte. Man erinnere sich an Ursula von der Leyen. Sie, die jetzt mehr für Rustüng ausgeben will, gab in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin vor allem mehr für Berater von Firmen wie McKinsey aus, die Bundeswehr und BMVg wie ein Unternehmen analysierten und für viel Geld in ein Korsett der Privatwirtschaft prügeln wollten.
Das funktioniert nicht. Zeitgleich ist das Amt für Wehrtechnik und Beschaffung, das „BAAINBw“, eine riesige Wasserkopf-Behörde voll von Beamten im schlechtesten Sinne. Junge Juristen, die noch nie einen Betrieb oder eine Armee von innen gesehen haben und nur noch in Verfahren, aber nicht mehr in Kategorien von Logik und gesundem Menschenverstand denken, schließen dort schlechte Verträge ab oder erlassen sinnlose Bestimmungen für die Produzenten. Dies muss genormt sein, das muss geprüft werden, hier eine neue Vorschrift, da ein Extrawunsch – effektive Arbeit der Auftragnehmer wird so oft verunmöglicht. Zeitgleich treibt ein System der organisierten Verantwortungs-Verschiebung und geistlosem Dienst nach Vorschrift zu Blüten wie der Beschaffung von Marine-Helikoptern, die nach Regulierung aber gar nicht für den Flug über Nord- und Ostsee zugelassen sind. Es ist die organisierte Unfähigkeit in einem Amt, das erst jetzt langsam reformiert wird.
Russland baut auf – was tut Europa?
Die europäischen Mitglieder der NATO haben wesentlich von dem, was man „latentes Potenzial“ nennt: Sie haben drei bis viermal mehr Menschen als Russland, und ihre kombinierten Volkswirtschaften sind rund zehnmal größer. Viele europäische Staaten, von Deutschland bis Schweden, verfügen immer noch über hochentwickelte Rüstungsindustrien, die in der Lage sind, ausgezeichnete Waffen herzustellen. Und die europäischen NATO-Mitglieder allein geben jedes Jahr mindestens das Dreifache von dem aus, was Russland für sein Militär ausgibt. Kurzum: Europa ist stärker als Moskau und hat mehr als genug Potenzial, um einen russischen Angriff abzuschrecken oder abzuwehren, wenn dieses latente Potenzial richtig mobilisiert und geführt wird.
Und die russische Armee ist kein Koloss: Obwohl ihre militärische Leistung und Produktionskapazität für Verteidigung sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs erheblich verbessert haben, hatte sie Schwierigkeiten, die in vielerlei hinsicht unterlegenen Ukrainer zu überwinden. Und eine Armee, die Monate braucht, um Bachmut oder Awdijiwka einzunehmen, wird sicherlich keinen erfolgreichen Blitzkrieg gegen NATO-Truppen starten. Noch nicht.
Die russische Armee mag in der Ukraine also viel von ihrem Mythos als übermächtiges Heer eingebüßt haben. Aber Putin ist dem Westen in einer Sache haushoch überlegen: In seiner Entschlossenheit. Die Russen haben ihre Kapazitäten hochgefahren, wie es nur geht – auf Kriegswirtschaft umgestellt. Strukturelle Schwächen, von denen Russland und sein Militär zweifelsohne eine Menge haben, werden Stück für Stück ausgebügelt. Der Staat strafft sich in Vorbereitung auf langfristige Ziele und Strategien. Russland macht sich strukturell kriegstüchtig und wird von den globalen Feinden des Westens unterstützt. Nordkorea und der Iran tun, was sie können, um den russischen Krieg mit Drohnen und Raketen zu unterstützen.
Ihre Waffenproduktion läuft wie geschmiert – bei dem, der Terrorgruppen wie die Hamas oder sein eigenes, überdimensionales Militär als stetigen Kunden hat, stehen die Bänder nicht still. Wie sieht es in Europa aus? Schlecht. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn haben wir noch immer keine nennenswerten Bemühungen in der Munitionsproduktion vorzuweisen. Das ist fast schon sträflich nachlässig.
Die Zukunft braucht Sicherheit und Wehrfähigkeit
Denn wie auch immer der Ukraine-Krieg konkret enden wird: Möglich ist eine Form von Waffenstillstandsvertrag unter Einbeziehung von NATO-Staaten, die den Krieg einfriert. Einfriert, aber eben nicht beendet. Putin zumindest hat keinen Grund, von seinem Ursprungsziel, der gesamten Ukraine, abzulassen. Solange irgendwo, ob westlich des Dnjepr oder darüber hinaus, noch eine westlich orientierte Ukraine existiert, ändert sich nichts an der Ausgangslage, die Putin zu seiner „militärischen Spezialoperation“ veranlasste.
Im Gegenteil: NATO und Russland stehen sich jetzt an hunderten neuen Grenzkilometern direkt gegenüber, Moskau und der Westen sind in einen handfesten kalten Krieg verwickelt. Die Lage ist deutlich schärfer, als sie noch 2022 war. Da braucht es robuste Verteidigung und Wehrfähigkeit – als Versicherung, als Abschreckung, als schlicht absolute Notwendigkeit.
Die europäischen Staaten ziehen es immer noch vor, in ihre eigenen Verteidigungsindustrien und Streitkräfte zu investieren, anstatt zusammenzuarbeiten, um Waffen zu standardisieren und eine gemeinsame Strategie und Verteidigungspläne zu entwickeln. Laut einem Bericht des Center for Strategic and International Studies im vergangenen Jahr ist zwar die Gesamtausgaben für die europäische Verteidigung seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 stark gestiegen, der Anteil, der für kooperative Beschaffungsbemühungen aufgebracht wird, fiel bis 2021 stetig. Man muss auch zugeben: Gemeinsame Rüstungsprojekte in der Vergangenheit, etwa der Airbus Eurofighter, waren in der Entwicklung kein Ruhmesblatt.
Aber die hartnäckige Tendenz, alleine vorzugehen, verschwendet den enormen latenten Ressourcenvorteil, den Europa gegenüber Russland hat – und könnte sich als Luxus erweisen, den es sich nicht mehr leisten kann. Aktuell ist es ein Wirrwar: Die Franzosen wollen beispielsweise ihre Dassault Raffale fliegen, die Schweden schätzen ihre Gripen-Jäger, die Polen setzen auf amerikanische Flugzeuge, und Deutschland hat für viel Geld den Eurofighter beschafft. In Zukunft wären gemeinsame Beschaffungen die bessere Option.
Dazu muss aber vor allem ein Land seine Störungen und Blockaden aufgeben: Deutschland. Denn Europa wird nur erfolgreich mit den Deutschen arbeiten können, wenn die auch wirklich mitmachen und ihre alten Marotten im Geist der „Zeitenwende“ über Bord werfen. Denn wenn schon wieder eine deutsche Schraube ein Exporthindernis wird, schon wieder eine deutsche Regulierung das Projekt sprengt, wird Europa schlicht ohne uns bauen müssen.
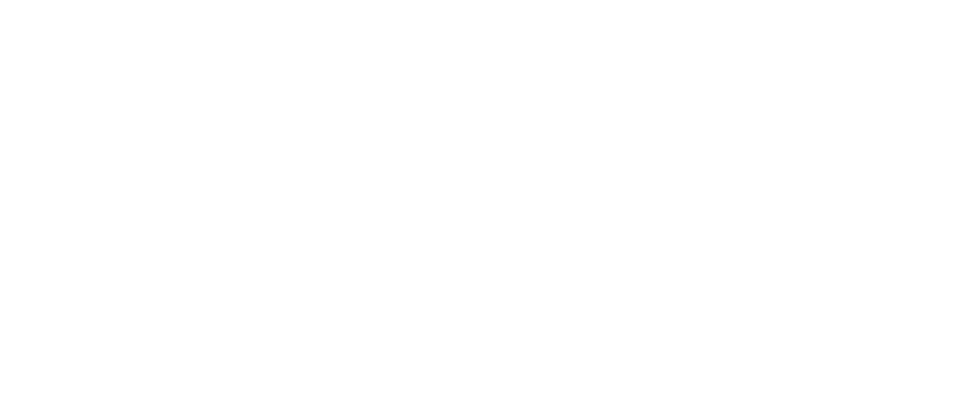
Warum bitte und gegen wen müssen wir „kriegstüchtig“ werden? Wenn´s nach Russland ginge, hätten wir seit 20 Jahren eine innige Freundschaft mit regem Handel und Innovationsaustausch. Handel und Diplomatie, statt Rüstung und Kriege!
Gütiger Gott ein Troll – oder doch nur ein Deutscher, der immer noch glaubt, dass Putin ehrlich ist und noch dazu ein lupenreiner Demokrat.
So wie Roth, Kretschmann, Brüderle, Fischer oder einfach wie die gesamte grün-rote Mischpoke, die hier in D die Sau rauslässt.
@ Norbert Jung
Schließe mich Ihrer Sicht an.
“ …der russische Eroberungskrieg gegen die Ukraine….“
Sehr geehrter Herr Roland,
einen ähnlich realitätsfernen Artikel zu diesem Thema habe ich schon einmal kommentiert.
Ihre Sicht wurde von der Leserschaft hier teils sehr deutlich abgelehnt.
Warum wieder ein Artikel, der den Vorlauf der Geschichte ausblendet ?
Es ist erschreckend zu sehen wie die Kriegsgeilheit hochkommt. Noch nie ein Gewehr in den Händen gehalten aber mit dem Maul schon in Moskau. Fürwahr, es ändern sich die Zeiten.
Und das mit einer Bundeswehr, die schlicht wehrunfähig ist.
Obristen die sich, gänzlich unprofessionell, dabei belauschen lassen wie russische Infrastruktur am blödesten zu beschädigen ist. Eine Regierung die nur noch wirr herumeiert, krakehlende Rüstungslobbyisten auf den Gehaltslisten der BlackRocks und hypermoralisierende Dummköpfe, die uns alle um Kopf und Kragen faseln.
Russland wird mit der Ukraine nicht zufrieden sein…
Es will den Rest von Europa auch.
So ein Unsinn. Russland ist das größte Land der Welt. Es umfasst mehr als zwanzig Prozent der Landfläche dieses Planeten.
Der Gigant will Frieden, Prosperität und Wohlstand. Sonst nichts.
Wenn’s nach Putin ginge, gäbe es die DDR noch.
Die gibt es ja auch noch, seit 89 allerdings ohne Schutzwall für den Westen.
ich vermissen jeden Tag, die DIPLOMATIE…
das Wort wird demnächst auch als Un-Wort geführt???
Gut, dass Putin immer wieder anspricht, dass es unsere Regierung IST!!! und nicht das Volk, aber das wird nicht in DEUTSCH übersetzt!!!!
Dann verhandeln Sie doch mit Putin.
Bin gespannt, was dabei rauskommt. Meine Heimatinteressen werden Sie wohl nicht vertreten.
Verhandeln wäre zumindet schon einmal etwas! Aktuell regiert der Geist der Kriegstreiberei. Ein Waffenstillstand wäre schon einmal ein Anfang.
Während der Kubakriese musste jedes verbreitete Wort und jede Tat richtig gedeutet werden. Das hat mich immer zutiefst beeindruckt, was damals geschafft wurde. Putin ist ein Mann des KGB und er versteht dieses Spiel sehr gut – auf jeden Fall besser als ich.
Sergei Nikititsch Chruschtschow hatte mal einst einen fürterlichen Disput mit seinem Vater Nikita Sergejewitsch Chruschtschow – es ging um die Kubakriese und wieso sein Vater zurückrudert hatte. Dessen Antwort soll ungefähr gelautet haben, daß sein Sohn noch keinen Krieg miterlebt hat. Dies sollte uns zu denken geben.
Eine weitere Eskalation könnte der Todesstoß für unser Land und die ganze Welt werden. Dann braucht man auch nicht mehr die Systemfrage stellen, denn dann gibt es nichts mehr, was man ändern kann.
Handel und Diplomatie ja, aber gleichzeitig mit einer glaubwürdigen Verteidigungsbereitschaft ohne gleich mit dem Säbel zu rasseln. Die EU hätte sich besser nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf eigene Stärken konzentrieren sollen, was sowohl Wehrhaftigkeit als auch wirtschaftliche Autarkie betrifft. Stattdessen hat sie sich devot transatlantischen Interessen angedient, sich von global-externen Interessen leiten lassen und handelt konsequent gegen die Interessen ihrer Bürger. Wen wundert’s da, wenn sie von aufstrebenden globalen Mächten vorgeführt wird? Wem gehören eigentlich die hiesigen Rüstungswerke tatsächlich? Wo sind die Zeiten geblieben, in denen bei gemeinsamen Manövern das Gerät der BW meistens am besten funktionierte?
„Stattdessen hat sie sich devot transatlantischen Interessen angedient“
Erzählen Sie doch nicht so einen Dummfug !
Die USA haben den europ. und besonders den dtsch. Natobeitrag schon immer angemahnt. Unsere Abrüstung dient ausschließlich dem Osten – wie man ganz besonders in diesen Tagen sehen kann – wenn man nicht blind ist, oder in der DDR antiamerikanisch sozialisiert wurde.
Schlafschaf. Wenn’s nach Russland ginge, würde Putin über Westeuropa regieren – schon allein um den Amis den „Vorhof“ abzujagen.
Der Kreml hat in den letzten 20 Jahren trotz aller „Freundschaft“ kräftig aufgerüstet – während wir abrüsteten. Und jetzt kommen Sie und erzählen Märchen. Erzählen Sie sie doch dem Märchenonkel Lawrow, der steht auf sowas.
Außerdem dreht sich nicht die ganze Welt um Russland. Der Westen hat auch noch andere Feinde. Kriegstauglich muss man in einer multipolaren Welt immer sein. Wenn Sie meinen „das muss nicht“, dann lassen Sie doch einfach mal Türen und Fenster offen stehn. Beim Zuschließen fängt die Verteidigungsbereitschaft nämlich an – im Haus wie im Land !
Dummes Pazifistengewäsch da immer !
Und noch etwas: Mit „Wortleser“ haben sie sich einen aussagekräftigen „Namen“ zugelegt: Das bedeutet: Man liest Worte, begreift sie aber nicht im Zusammenhang!
„Nomen est omen! Im moralisch besten Falle krankheits- oder behinderungsbedingt: Dyslexie.
Die Ausgaben für das Millitär lagen bei der Nato ges.
2023 bei etwa 1,3 Billionen Dollar. Die von Russland
bei etwa 83 Milliarden. Wer hat aufgerüstet?
@Wortleser: Das ist genau die Diskussionsart, die in der BRD Einzug gehalten. Sie zählen sich zu den vermeintlich Schlauen und sind meines Erachtens einer der Dummen, die gefährlich sind.
Und Sie haben offenbar nicht den Mut mit Ihrem eigenen Namen zu kommentieren!
Und Worte lesen reicht nicht, sondern man muss Zusammenhänge begreifen.
Das glaubten die Ukraiener auch ein mal. Also ich war noch nie ein großer Fan der russischen Märchen, besonders jene die heute auf sämtlichen Telegramski Kanälen verbreitet werden.
Die New York Times hat einen Bericht veröffentlicht… (ist ja nicht gerade als Aluhutmedium anzusehen) Dieses Programm erstreckt sich über drei verschiedene US-Präsidenten und ein Jahrzehnt und hatte zum Ziel, die ukrainischen Geheimdienste zu modernisieren und sie zu wichtigen Verbündeten gegen Russland zu machen.
https://weltwoche.de/story/zwoelf-cia-bunker-in-der-ukraine/
https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html
Wenn russische Panzer in Berlin auftauchen, wird das Umweltministerium sie schon darauf aufmerksam machen, dass in Berlin-Mitte die „Umweltzone Berlin“ gilt und eine Grüne Plakette Pflicht ist.
…aber bitte mit kyrillischen Buchstaben, aber Fr. Merkel kann übersetzen
Haben Atomwaffen eine Abschreckende Wirung? – Warum labern EU Politiker dann so einen Gefährlichen Schwachsinn? – Kriegstreiber müssen sofort aus Ihren Ämtern entfernt werden. – Wer Kriegstreiber in Ämtern zulässt fördert die Kriegsmöglichkeit. Keiner dieser Kriegstreiber wird im Krieg an der Front sterben. Schaut in die Ukraine, Selensky und seine Kumpels sterben nicht an der Front. Gleichzeitig wächst das Bankkonto von Selensky jeden Tag. Ein Krieg wird ausgelöst von Reichen und Mächtigen um sie reicher und mächtiger zu machen. Sterben tun die Dummen und die Armen. Erst wenn Hofreiter, Strack-Zimmerman und die Kriegsgeilen Journalisten an der Front sind, dann glaube ich ihnen das sie auch meinen was sie sagen. Schaut in die Geschichte, wer starb im Krieg und wer war danach reicher?
Die ukrain. Verteidigung mit westl. Hilfe ist genausowenig „Kriegstreibend“ wie die Israelische mit amerik. Hilfe.
Das ist Putins Angriffskrieg auf die Ukraine – er kann ihn sofort beenden.
Genauso wie es ein islam. Angriffskrieg auf Israel ist – die Hamhasser können ihn sofort beenden.
Kriegstreiber sind in beiden Fällen allein die Angreifer !
Volle Zustimmung!
„Wir“ müssen nicht kriegstüchtig werden. Für Russland macht es keinen Sinn, in Westeuropa einzumarschieren. Kriege finden nur wegen Bodenschätzen, Grenzziehung und Bevölkerungsabgleich statt. In der Ukraine geht es um genau diese drei Punkte. In Westeuropa gibt es keine Bodenschätze, die Grenzen sind egal, die Bevölkerung ist nicht russisch und muss nicht „heim ins Reich“. Die russische Armee war noch nie eine „Über-Armee“, selbst im WW2 nicht. Die haben damals nur das getan was notwendig war, um nach Berlin zu kommen. Genauso ist der Stand bei denen heute. Mir scheint, dass ihr alle früher zu viel „Alarmstufe Rot“ gezockt habt. Das hatte aber noch nie etwas mit der Realität zu tun. Also bitte weniger Kriegsgeschwafel und bitte mehr Berichterstattung über das abgehörte Telefongespräch zum Thema „Taurus & die Krimbrücke“ = ist es wahr oder nicht usw. – das würde mich sehr viel mehr interessieren
Volle Zustimmung!
Es gibt für Russland nichts in Deutschland zu holen. Keine Bodenschätze, keine Kornkammer. Unsere einzigen „Rohstoffe“ sind Erfindergeist, Fleiß, Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit ( aber selbst das schwindet ja zusehends). In einem besetzten, unterdrückten Land verkümmern diese geistigen Rohstoffe rasant, siehe DDR. Das weiß auch Putin. Stattdessen waren wir ein Großabnehmer für russische Rohstoffe und Energieträger. Warum sollte Putin einen seiner besten Kunden abwürgen und Unsummen an Geld und Personal für eine Besatzung investieren?
Darum gehts doch gar nicht. Es geht um Russlands antiamerikanische Einflußnahme in Europa. Und zu diesem Zwecke, dienen ihm u.a. ein paar Milliönchen DDRler. Die russ. hybride Kriegsführung durch verbündete Bevölkerungsteile in DE, findet man in ganz Westeuropa kein zweites mal – außer es sind separatistische Russen. Der Rest von Russlands „abtrünnigen“ Satelliten ist bevölkerungstechnisch mehrheitlich froh, die Russen los zu sein. Und das kann der Kreml unter Putin nicht verknusen.
Wer erzählt denn so einen Quatsch. 5 Milliarden hat sich die USA den Maidan kosten lassen. Der Krieg ist seit 2014 gestartet und wird so lange andauern bis solche Kräfte verschwinden, die den Hegemon nicht absagen. Dieser Hegemon macht auch vor China, Indien nicht halt. Will man das alles unterstützen? Warum… den USA geht es nicht um uns, die haben andere Ziele! Fuck the EU sagt mehr als alles andere darüber aus. Die EU und Deutschland sind für ihre Bürger zuständig und sollen neutral bleiben, erst mal Besatzungsfrei werden, und Neutralität anstreben.
@Wortleser
Ihre Beiträge: Das kann Verfolgungswahn sein oder Zeugnis erfolgreicher Indoktrination.
Ich wohne auch dort wo die „Milliönchen DDRler“ wohnen. Und? Wir sind froh, dass wir die loshaben. Ei ei… und ich denke mal, dem Putin wirds völlig egal sein, ob wir froh sind oder nicht. Wieso sollte man für Millionen von „Geld“ Waffen einsetzen und Leute opfern, nur um jemanden zu „besetzen“? So dumm war nur einer, der hat 1945 ins Gras gebissen. Aber ja, ist klar: viele Westdeutsche haben die Niederlage von damals noch nicht verkraftet/ verarbeitet. Da ist noch was offen, also versuchen „wir“ es nochmal – mit gleichem Ausgang, nur ein wenig schneller und ein bisschen lächerlicher.
Die Kriegstrommeln dröhnen. Einige können es offenbar gar nicht abwarten, bis Deutschland endlich mit Russland im Krieg ist. Wahnsinn!
Es war Außenminister und Vizekanzler Josef Fischer, auf dessen Betreiben die Schröder-Regierung die Verteidigungsarmee Bundeswehr 1999 in den ersten Fronteinsatz ins ehemalige Jugoslawien nach dem Gründung der Bundeswehr geschickt hatte.
Und um es noch einmal klar zu sagen, dieser Herr Fischer gehörte der Bündnis90/Grünen und für Frieden demonstrierenden Partei seit ihrer Gründung an!
Und es war ein Einsatz ohne UNO-Mandat. Ein erster Test womöglich?
Was ist gegen Trumps Aussage einzuwenden, wenn Europa seinen Verpflichtungen nicht nachkommt ist das eben die Konsequenz.
Man macht sich unglaubwürdig, wenn man nicht einmal dazu bereit ist, sich an unterschriebene Verträge zu halten.
Hat der Adolf ein neues Buch aus dem Jenseits gechannelt, „Mein bunter Kampf“? Es verbreitet sich in Großauflage ohne Papier und Druckfarbe massenhaft in den Köpfen, bei Generälen und über die Zwangsbeitragsmedien bei einigen hunderttausend besonders untertänigen Charakteren, die auf bunten Amtsbefehl auf den Straßen schon das Marschieren gegen rechts auf dem Globus üben. Der größte politische Betrug der BRD-Nachkriegsgeschichte, die Grünpartei, die vom inszenierten Pazifismus zum inszenierten Bellizismus mutiert wurde, ist ebenfalls verwickelt, zumal von ihrem Anfang an neben bodenständigen Naturschützern (als Lockvögeln?) internazionalistische Agenten der sog. Frankfurter Schule mitgemischt haben.
Ich bin der Meinung, das unsere Oberfeministin ununterbrochen in Moskau verhandeln müsste. Im schlimmsten Fall bekommt Putin die Ukraine und Europa, erst einmal, Frieden. Von wem wir Getreide und Rohstoffe bekommen ist doch vollkommen egal. Korrupt und verschlagen sind beide Parteien am Don. Die USA müsste raus aus Europa und dann kann über wehrhafte Nationalstaaten gesprochen werden.
Wie kompetenzlos diese ist, haben wir im Februar 2022 feststellen dürfen. Niemand auf dem Globus nimmt diese Schreckschraube mittlerweile mehr ernst. Der Zwischenfall in Brasilien sollte ihre Gewäsch bei der UNO verhindern.
Die Bundeswehr ist in ihrer derzeitigen Verfassung nicht in der Lage einen Krieg zu führen – ihr fehlen die Soldaten, ihr fehlt die Ausrüstung, ihr fehlen die Waffen und die Munition und dass wir jeden Tag zwanzig Lastwagen voller militärischer Güter nach Kiew schicken, macht die Sache für unsere Soldaten auch nicht besser. Die Bundeswehr wurde von den gleichen Politikern für „unmoralisch“ und „Nazi“ erklärt, die heute für den Krieg trommeln und es kaum noch erwarten können, unsere Soldaten in den Kampf zu schicken. Die Moral der Truppe ist völlig zerstört, das Vertrauen in die militärische wie politische Führung praktisch nicht mehr vorhanden, weil jeder Soldat weiß, dass er sofort wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird, sollte er auch nur ein falsches Wort sagen oder wenn er das falsche Modellflugzeug in seiner Stube stehen haben. Die Truppe ist nicht in der Lage zu kämpfen.
Es galt einen Militärputsch gegen die Faschisten unmöglich zu machen.
Wenn die Russen wirlich irgendwann ein NATO Land angreifen, ist bestimmt die AfD schuld.
Der Artikel hier könnte auch in jedem Mainstreamblatt stehen. Will der Autor Angst und Panik vor einer russischen Invasion verbreiten oder sich irgendwo anbiedern ?
Den Eindruck kann man wirklich bekommen.
Ich hatte nach dem ersten Artikel mit solcher Schräglage
überlegt, hier nichts mehr zu schreiben.
Ich suche ebenfalls nach einer Erklärung.
Nein, der ist nur nicht auf DDR-Trip !
„Notwendige Aufrüstung“? Was für ein Schwachsinn, mit Verlaub.
Ziel der Amerikaner,Briten und Franzosen ist und war es von jeher,die Verbindung von dt.Technik und dem dt. Know How mit russ.Bodenschätzen zu sabotieren.Leider spielen die amerik. Büttel (dt.Regierung) in dieser Geschichte eine herausragende Rolle…Zum Thema Ukraine,Aggression und Ursache lest euch den offenen Brief von General a.D. Schultze-Rhonhof durch,dann wisst ihr wer der Schuldige an der Eskalation in diesem Konflikt ist.
Nun schon die Alten wußten: si vis pacem para bellum – Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor.
Wenn das wahr ist, ist auch das Gegenteil wahr: Wenn du Krieg willst, rüste ab.
Und leider hat dies wohl die Verteidigungspolitik Europas der letzten gut dreißig Jahre bestimmt: Man hat verquast pazifistischen Dilettant*innen, deren Qualifikation oft kaum über eine Beamtenlaufbahn oder die Parteikarriere hinausging, die Verantwortung für die Vteidigungsfähigkeit übertragen.
So etwas rächt sich; nicht sofort im Heute oder Morgen, aber im Jetzt.
Nach der x-ten politisch oder ideologisch motivierten „Umstrukturierung“ der Streitkräfte ist von deren „Verteidigungfähigkeit“ kaum noch etwas vorhanden, weil man wohl aus dem Blick verloren hat, daß der Daseinszweck von Streikräften in der Verteidigung der Demokratie besteht, aber nicht in ihrer Anwendung.
Na und die Sicherheit schaffen wir erst einmal, indem wir uns in den Krieg mit Russland stürzen. Diese Idee ist letztlich auch nicht schlecht- löst sie doch binnen Kurzem alle zukünftigen Probleme. Von daher: Na denn man los Ihr komplett Wahnsinnigen!
Egal wie es heißt ,mit der Bundeswehr selbst zu Zeiten des Kalten Krieges konntest du keinen Blumenstrauß gewinnen ,und das ist heute nicht anders.
So wie ich das lese hat der Autor nicht von der der Gefahr einer russischen Übernahme geschrieben. Diese „Gefahr“ gibt es nicht. Man kann Putin&Genossen für gefährlich halten, blöd sind die nicht. Eine BRD im heutigen Zustand brauchen die im Kreml ungefähr wie ein Loch im Kopf.
Einer der Punkte ist aber, wir sind nicht verteidigungsbereit und auch nicht verteidigungsfähig – weder von der Einstellung noch von der Technik.
Wir sind weder bereit noch in der Lage unsere eigenen Bürger irgendwo auf dieser Welt, noch die Versorger auf den Handelsrouten dieser Welt zu schützen.
Wir dachte zu lange „Pappa USA“ macht das für uns. Die haben aber genug mit ihren eigen Probleme zu tun, das war die Ansage von Trump damals.
In der Ukraine sind wir bereits mitten in einem Stellvertreterkrieg RUS-US verhaftet. Wozu? Warum? Weshalb? Keiner weiß es (wirklich). Fähig daran teil zu nehmen sind wir auch nicht. Unsere „Laberexperten“ sind oft nicht mal in der Lage Kain von Abel zu unterscheiden.
Chronischer Munitionsmangel zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Geschichte der BRD. Leider finde ich dazu nichts mehr im Internet, aber ich meine es war in den 70ern ein General, der sagte, daß im Kriegsfall Deutschland ein oder zwei Wochen ein spektakuläres Feuerwerk zünden könnte, jedoch danach würde die Munition ausgehen. Inzwischen sind wir bei zwei Tagen angekommen.
Nach dem Kalten Krieg wurde der Verteidigungshaushalt zugunsten sozialer Geschenke völlig ausgeplündert. Nicht daß ich und andere unbedingt einen Krieg haben möchte (das wäre furchtbar!), aber für den Fall aller Fälle möchte ich dafür gerüstet sein.
„Wer den Frieden wünscht, bereite den Krieg vor.“ (Flavius Vegetius Renatus)
Einverstanden! Europa, insbesondere Deutschland muss verteidigungsfähig sein. Aber von Vulgärpatriotismus zu sprechen, ist schon interessant. Momentan leiden wir eher Vulgärbellizismus. Im übrigen sollte die Wehrpflicht wieder „eingeführt“ werden. Für m/w/d natürlich. Die Apollo Redaktion kann dann wahrscheinlich erstmal Pause machen. Ich habe als alter weisser Mann schon meinen Dienst abgeleistet. Und für die Verteidigung gebe ich auch gerne mehr Geld auf . Soli?
Vulgärbellizismus, in der Tat. Da bin ich selber Meinung. Statt auf das Beschaffungsamt zu schielen sollte man den Tatsachen ins Auge sehen. Um die Wehrpflicht wird kein Weg herum führen. Irgendwer muss das schicke Spielzeug ja bedienen können. Ich bin ganz vulgär für Frieden und bekenne mich dazu. Abwehr ja. Aber Abschreckung führt nur in Aufrüstungsspiralen, daher: nein.
Keine Wehrpflicht! Ein soziales Dienstjahr, welches man auch beim Bund ableisten kann, wäre meiner Meinug nach sinnvoller. Das schafft Bindung mit dem Land in dem man wohnt und lehrt Demut für die Gesellschaft. Was es nicht braucht sind Gap-Years in Übersee. Das erzeugt nur die Art von Schwurbelei, wie es die Grünfaschisten uns jahrelang versucht haben einzutrichtern.
Wir brauchen keinen Wehretat-Soli. Wir leisten mehr als genug Steuern. Die allerdings für idiotische Dinge im Ausland verpulvert werden.
Perfide und Geschmacklos sind allerdings solche Sachen :
https://report24.news/wieder-zdf-logo-jetzt-irre-kriegs-und-waffenpropaganda-fuer-kinder/
Wer Kinder derart indoktriniert, kalkuliert natürlich für 20 Jahre im voraus. Kindern soll ein „gesundes“ Verhältnis zu Waffen nahegebracht werden. Es scheint zu pressieren, denn diese Machart kannten wir im Westen nicht mal im kalten Krieg. Eher ähnelt es dem DDR-Bildungsauftrag und nicht weniger dem der Russen, Chinesen, N-Koreanern und natürlich der islamischen Welt, obwohl die sich mit Kindgerechten Niedlichkeiten eigentlich weniger aufhalten. Dort weiß schon jeder 6jährige was die Uhr geschlagen hat.
Was mich langsam wirklich ankotzt, ist Putins Erpressungsmittel Nr.1 Nuklear-Waffen, mit denen er ständig droht, um seine kriegerischen Pläne durchzusetzen. Langfristig ist eine Entnuklearisierung in Russland angezeigt.
Na dann, nur zu. Entnuklearisierung Russlands, gute Idee! 👍