Heute vor fast 250 Jahren – 247, um genau zu sein – erklärte der Kontinentalkongress der Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit von Großbritannien und „dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“
In den zwei Jahrhunderten, die folgten, stiegen die USA von einem Haufen rebellischer Kolonien zur Weltmacht auf. Ihre Ideale folgten ihnen, sei es als Vorbild der „Shining City Upon A Hill“ oder in Form von Soldaten, die die Strände der Normandie oder Iwo Jimas stürmten.
Die „Stars and Stripes“ haben inzwischen ihren festen Platz in der Welt gefunden. Aber in Deutschland redet inzwischen so manch einer den amerikanischen Untergang herbei. „Bei uns darf es bloß keine amerikanischen Verhältnisse geben!“, heißt es immer wieder aus der deutschen Politik. Mit erhobenem Zeigefinger spricht man über Washington: Gespalten, dysfunktional, eine „Demokratie in der Krise“ sei das Land, heißt es.

Völlig ignorant ist man dabei gegenüber der Tatsache, dass gerade Streit Kern der demokratischen Debatte ist. „Ehrgeiz muss Ehrgeiz entgegenwirken“, schrieben einst die amerikanischen Gründerväter. Soll heißen: Widerworte, Ablehnung, gegenseitige Blockade gehören fest zum politischen System dazu, ja sind sogar notwendig, damit die Staatsgewalten sich gegenseitig kontrollieren und nicht im Gleichschritt marschieren.
Die Trump-Keule in der deutschen Debatte
Besonders beliebt zur Verteuflung der amerikanischen Politik in der deutschen Debatte der letzten Jahre ist die Figur Trump. Denn wenn sich jemand Widerworte leistet, dann wohl er. Wer auch immer es dementsprechend wagt, dem linksliberalen Mainstream hierzulande zu widersprechen – oder wer es noch nicht mal tut, aber bei dem die Gefahr im Raum steht – der gilt sofort als der „deutsche Trump“: Sei es Friedrich Merz, Markus Söder oder Hubert Aiwanger.
Mit kaum einem anderen Phänomen wie dem Trumps und des „Trumpismus“, worunter in Deutschland inzwischen so ziemlich jeder Republikaner, inklusive Trumps Hauptrivale in der Vorwahl, Ron DeSantis, einsortiert wird, jongliert der Politbetrieb wohl so gerne. Die Story geht dann ein bisschen so: Trump ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat durch „Hass und Hetze“ die Hälfte des Landes gegen die Demokraten (und womöglich die Demokratie) aufgebracht. Er habe seine Anhänger angestachelt, Hillary Clinton zu hassen.
Die Wahrheit sieht anders aus: Ja, Trump kam zwar aus dem politischen Nichts, aber die Abneigung gegenüber Clinton, die wie keine andere das linke Establishment in den USA repräsentierte – die war schon längst da. Die hat Trump nicht erfunden, denn sie bestand auf Gegenseitigkeit, wie Clinton im Wahlkampf demonstrierte, als sie meinte man könne mindestens die Hälfte der Unterstützer des späteren Wahlgewinners in einen „Korb voller Bedauernswerter“ fallen: „Sie sind rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich, islamfeindlich – was auch immer.“
Genau diese Haltung legen linke Politiker in Deutschland an die Reihe, wenn es darum geht ihre Politik als „alternativlos“ zu rechtfertigen: Sie sind mit einer Politik der offenen Grenzen nicht einverstanden? Rassist! Sie wollen, dass Positionen in Staat und Gesellschaft nach Leistung nicht nach Geschlecht besetzt werden? Sexist! Sie sind der Meinung man kann sein Geschlecht nicht jährlich ändern? Transphob! Sie sind der Meinung es sollte so etwas wie eine Leitkultur in diesem Land geben? Fremdenfeind!
US-Parteien liefern „eine Alternative, kein Echo“
Dieses ganze Trump-Argument dient vor allem einem: Einen klaren politischen Gegenentwurf zu verhindern. Alles, was es geben soll, ist maximal eine „Ja, aber langsamer“-Opposition. Und genau deshalb blickt man herab auf die ach so schlimme Spaltung in den USA. Denn dort bieten die Parteien klare Unterschiede: Demokraten und Republikaner haben jeweils eine eigene Vision für die Zukunft des Landes, die grundlegend in eine andere Richtung geht. Gegenüber den gerade regierenden Demokraten bieten die Republikaner den Wählern „eine Alternative, kein Echo“, wie es die konservative Aktivistin Phyllis Schlafly einst als Schlagwort prägte.

In den USA praktiziert man anders als hierzulande eine Politik der klaren Unterschiede. Das muss nicht bei allem besser sein, aber es hat sich bewährt. Schließlich hat die amerikanische Verfassung, nur ein paar Jahre jünger als die Unabhängigkeitserklärung, mehr als zwei Jahrhunderte auf dem Buckel. Und auch wenn sich in Amerika genauso Parteieliten bilden können – die Wahl von so manchem US-„Populisten“ zeigt, wie schnell die Wähler solche Eliten ersetzen. Das sieht bei uns durchaus anders aus.
Diesen Unabhängigkeitstag könnten wir uns also fragen: Verträgt unsere Politik nicht vielleicht einen Funken Amerika? Parteien, in der die Basis mehr zu sagen hat als Funktionäre? Ein Parlament, das die Regierung kontrolliert und nicht durchwinkt? Ein Verfassungsgericht, das außerhalb des Establishments steht?
Man muss ja nicht gleich alles kopieren, aber ein Hauch Wild West täte uns wohl ganz gut.


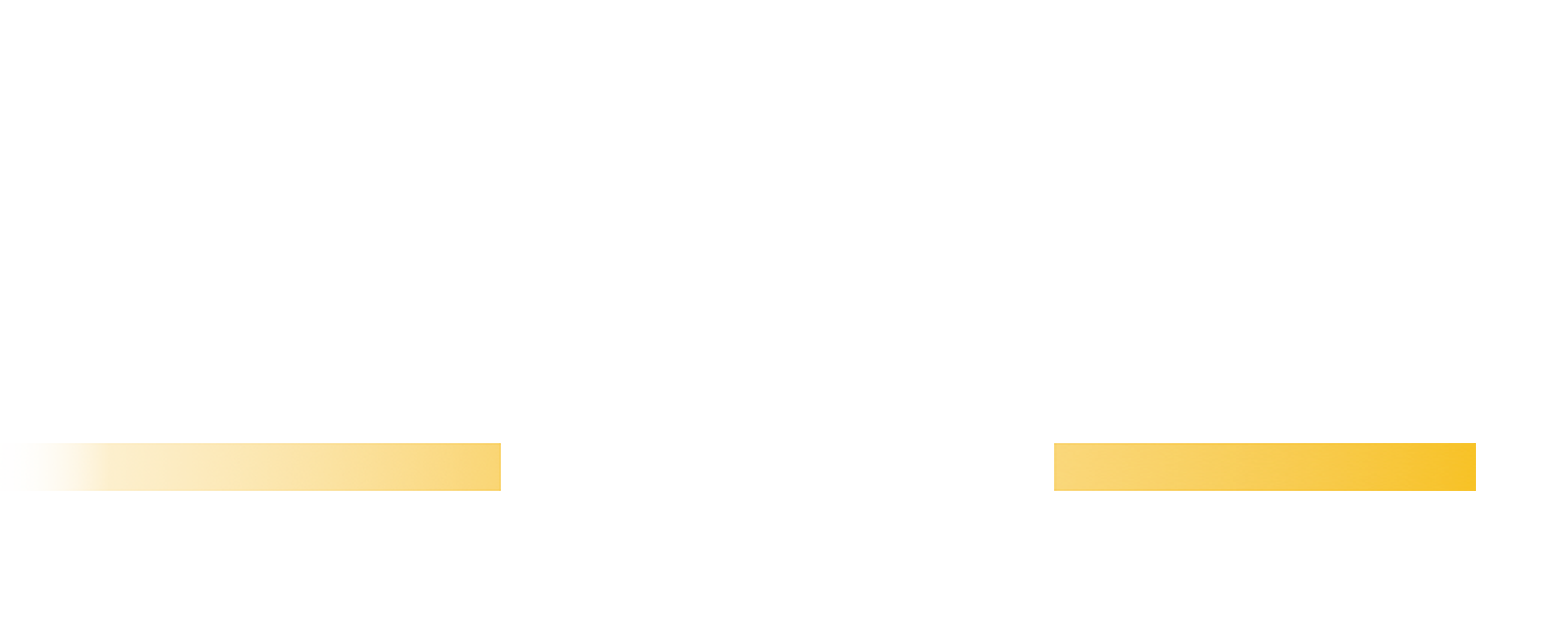
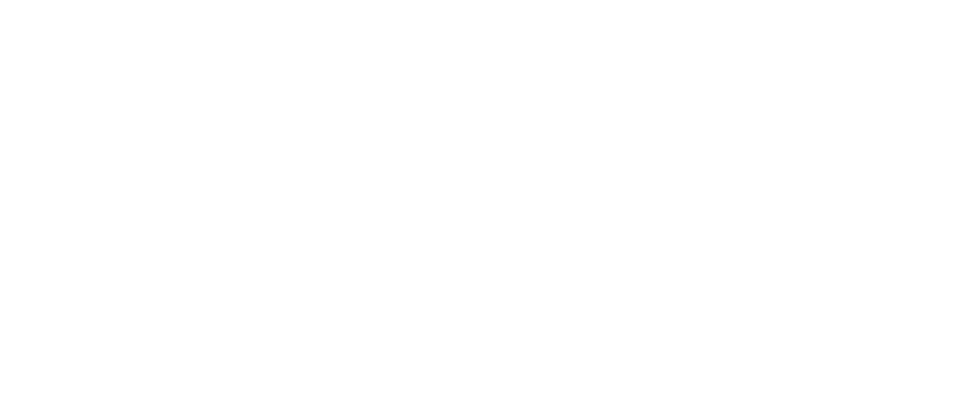
Den Amerikanern verdanken wir die Existenz unseres Staates. Das sollten wir niemals vergessen.