Bye bye, Sex and the City
Die Fortsetzung von „Sex and the City“ wird endgültig eingestellt. Der rbb freut sich, weil die Sendung zu „weiß, heterosexuell, schlank und reich“ war. Doch es gibt andere Gründe sich über das Serienende zu freuen

„And just like that“, die Fortsetzung der Kultserie „Sex and the City“ (1998-2004) ist gecancelt. Aber nicht die Art von gecancelt, bei der man aus der Gesellschaft verbannt wird, weil man politisch inkorrekt war. Nein, die Art von gecancelt, bei der man vom Programm gestrichen wird, weil einen niemand mehr sehen will. Meistens – und so auch hier – weil man versucht hat, politisch korrekt zu sein und im Ergebnis nur noch peinlich war.
Da die Sendung „Sex and the City“ meine erste Kolumne inspiriert hat, fühle ich mich von dieser Meldung natürlich angesprochen. Und damit genug, um eine Ausrede zu finden, um wieder darüber zu schreiben und mich dabei selbst wie Carrie Bradshaw zu fühlen, wie sie mit einem Martini-Glas am Computer direkt am Fenster sitzt und ihren inneren Monolog aufschreibt und es Journalismus nennt.Sie zahlen monatlich Ihren Rundfunkbeitrag, damit ich etwas zum Schreiben habe. Dieses Mal ist es Radio eins vom rbb, der mir meinen Stoff liefert – besondere Grüße gehen raus an die Leser und Beitragszahler in Berlin-Brandenburg und alle, die mir diesen Beitrag zugeschickt haben, denn wenn ich in meiner Karriere eins erreicht habe, dann dass man bei Sex and the City an mich denken muss. Ich hoffe, dass Kolumnistin sein und einen Hang zu Martini-Gläsern zu haben, die einzigen Eigenschaften sind, die ich mit Carrie gemein habe, vor allem mit Blick auf die Reboot-Serie „And just like that“, aber ich greife mir mal wieder voraus.
Werbung
Die Post-Sex-and-the-City-Ära
Zunächst zum Radio-Eins-Beitrag: Unter dem Titel „Bye-bye, Sex and the City – das Ende einer Ära“ hat man sich die „ausgewiesene Film- und Serienexpertin“ Anna Wollner dazu geholt. Denn – wie man uns im Vorspann einweist – ist die dringendste Frage zu dieser Stunde: „Wie feministisch ist die Serie eigentlich?“ Was für eine dämliche Frage direkt zum Einstieg. Sex and the City ist – wie man auch selbst im Vorspann erklärt – 1998 als „provokante Serie für ein vor allem weibliches Publikum“ gestartet worden.
Selbstverständlich wird man sie aus heutiger Sicht nicht mehr so revolutionär finden, wie sie damals war. Immerhin leben wir in einer Post-Sex-and-the-City-Ära, sie wäre damals nicht so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht einen Nerv getroffen hätte. Und wenn man sieht, wie sich der Feminismus heute radikalisiert und praktisch in sein Gegenteil verkehrt hat, kann man sich auch schon denken, welche Antwort man auf diese Frage finden wird.
Und tatsächlich: „Aus heutiger Sicht ist es erschreckend, wie weiß, heterosexuell, schlank und reich die Serie damals war. Wir haben das einfach so hingenommen“, heißt es. Ohje. Lustig ist, dass sich beide, trotz alldem schon zu Beginn in einem einig sind: Nämlich, dass sie sich das Ende von „And just like that“ beinahe schon herbeigesehnt haben. Und das, obwohl „And just like that“ alles – wirklich absolut alles – getan hat, um Sex and the City weniger weiß, heterosexuell zu machen. Das mag nicht völlig auf die politischen Hintergründe zurück zu führen sein. Es gibt auch liberal-konservative Serien, die schlecht gemacht sind. Aber es ist ein Sinnbild unserer Zeit, die von Politik – und ganz besonders einer politischen Richtung – gezeichnet ist.
Lesen Sie auch:
Gegen „Incel-Propaganda“
Für Polizisten und Richter: EU-Ausschuss will verpflichtende Schulungen gegen „schädliche Geschlechterstereotypen“
Ausschüsse des EU-Parlaments fordern, dass Richter, Staatsanwälte und Polizisten Schulungen absolvieren müssen, um „schädliche Geschlechterstereotypen zu beseitigen“. Zudem soll die Definition von Vergewaltigung geändert werden – zum „Ja heißt Ja“-Prinzip.Bei Maischberger
„Zehntausende Menschenleben gerettet“: Baerbock lobt sich für ihre „feministische Außenpolitik“ in Afghanistan
Bei Maischberger verteidigt Annalena Baerbock die UN und behauptet: Ohne die Vereinten Nationen würden Menschen „einfach komplett verhungern”. Gäbe es die Organisation nicht, würden außerdem Flugzeuge abstürzen, meint sie.„Sex and the City“ war – zumindest für die Zielgruppe – genial gemacht. Stilvoll, humorvoll, ästhetisch, jede Frau konnte sich in einer oder irgendwie allen der vier Hauptcharaktere Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda wiederfinden und repräsentiert fühlen, und wenn die vier über Männer, Liebe und das Leben diskutierten, sich selbst und die Welt um sich herum reflektieren. Alle vier Frauen sind fundamental unterschiedlich. Carrie sucht kopflos nach der Liebe. Charlotte will um jeden Preis heiraten und die perfekte Familie gründen und alles schon durchgeplant haben, von der Anzahl der Kinder bis zur Höhe der Hecke. Samantha will Sex haben wie ein Mann, Miranda will wie ein Mann Karriere machen.
Über die Serie hinweg stoßen sie in ihren linearen Vorstellungen von dem perfekten Leben als moderne Frauen in einer großen Stadt auf Hindernisse und keine von ihnen endet zu hundert Prozent da, wo sie es erwartet haben. Aber sie lernen sich auch selbst besser kennen und entfalten sich neu, ohne dass sie sich fundamental verändern. So wie es im echten Leben auch ist. „Sex and the City“ hat einen beruhigenden Effekt und ist gleichzeitig aufregend. Als hätte man eine extravagante Gruppe von Freundinnen, in der man so akzeptiert wird, wie man ist und die Höhen und Tiefen des Lebens meistern kann.
Werbung
Der Fokus liegt auf den Frauen. Sie müssen Verantwortung in ihrem Leben übernehmen und daran arbeiten, sich ihr Leben aufzubauen. Es werden die Fragen gestellt, die Frauen umtreiben, und Fehler gemacht, die zum Nachdenken anregen – gleichzeitig bleibt die Serie so abgehoben und realitätsfern, dass es Spaß macht, in diese glamouröse New Yorker Welt einzutauchen und abzuschalten. Sie animiert, aus sich herauszukommen, man selbst zu sein, Raum einzunehmen.
Non-binär, lateinamerikanisch, langweilig
Das ist, was „Feminismus“ oder „Female Empowerment“ Ende der Neunziger, Anfang der 00er-Jahre bedeutet hat. Um Frauen geht es heute aber nur noch oberflächlich. Wirklich unterschiedliche Lebensentwürfe unter Frauen werden heute auch nur noch auf dem Papier unterstützt. Politische Korrektheit befördert kein befreiendes Aus-sich-herauskommen, sondern vielmehr ein in-sich-zusammenschrumpfen, die eigenen Bedürfnisse aus Rücksicht in sich zu behalten und so wenig Platz wie möglich einzunehmen.
In „Sex and the City“ wurden Frauen gezeigt, die erstmal ausgesprochen haben, wonach ihnen der Sinn stand und bei unterschiedlichen Meinungen diskutiert und vielleicht auch mal gestritten haben. „And just like that“ zeigt Frauen, die sich selbst zensieren und nur noch damit beschäftigt sind, alles „richtig“ zu machen. Jedes Mal, wenn sie sagen, wonach ihnen der Sinn steht, bedeutet das verurteilende Blicke oder peinliche Situationen.
Werbung
Carrie existiert nicht mehr. Sie, die früher noch ihre Kolumne „Sex and the City“ in der Zeitung veröffentlicht hat, ist mit der Zeit gegangen und produziert nun einen Sex-Podcast, gemeinsam mit „Che“. Damit hat die Serie ihre Ich-Erzählerin verloren, denn in „Sex and the City“ war jede Folge eine Kolumne und so durch Monolog umrahmt. Und sie hat ihren Glamour und ihre Fixierung auf das weibliche Publikum verloren.
„Che“ ist non-binär und lateinamerikanisch, eine politisch-korrekte Wunderkugel und Carrie kann natürlich eigentlich nur von ihr lernen. In dem Podcast wird nicht mit Metaphern und rhetorischen Fragen gearbeitet, da wird man einfach offen gefragt, ob man schon mal in der Öffentlichkeit masturbiert hat. Und ansonsten geht es nur noch um neue Geschlechter und Sexualitäten. Langweilig.
Charlotte mit ihren konservativen Vorstellungen von einer perfekten Familie und einem bürgerlichen Leben existiert auch nicht mehr. Sie ist nicht mal mehr ein Schatten ihrer selbst, wie sie stotternd versucht, ihre eine Tochter mit den richtigen they/them-Pronomen anzusprechen und für ihre andere Tochter durch einen Schneesturm Kondome zu besorgen.
Werbung
Samantha existiert im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr. Denn Kim Cattrall, die Schauspielerin, die sie verkörpert hat, hat sich geweigert, an der neuen Serie mitzuarbeiten. Sie wurde durch zwei neue schwarze Charaktere ersetzt. Miranda existiert auch nicht mehr, allerdings aus dem genau gegensätzlichen Grund. Die Schauspielerin Cynthia Nixon, die sie verkörperte, kritisierte Sex and the City schon 2019 als zu weiß und privilegiert.
Die Vogue zitierte sie damals mit dem Satz: „I believe certainly that we would not all be white today. God forbid.“ Später erklärte Nixon, dass sie nicht für die neue Serie zurückgekommen wäre, wenn sie nicht woke geworden wäre. Wahrscheinlich ist ihr Charakter deshalb am schlimmsten verunstaltet worden. Miranda gibt ihren Job als erfolgreiche Anwältin auf, um Menschenrechte zu studieren und Menschenrechtsanwältin zu werden. Ihre schwarze Professorin an der Universität bringt ihr dann bei, wie man als Weißer antirassistisch wird.
Der „White-Savior-Komplex“ und das Ende des Feminismus
Das endet damit, dass Miranda, als sie sieht, wie eine schwarze Frau in der U-Bahn ausgeraubt wird, zögert zu helfen, weil sie Angst hat, nur ihren „White-Savior-Komplex“ auszuleben. Denn wie ihre Professorin sie aufklärte, ist es auch rassistisch, wenn Weiße meinen, sie müssten Schwarzen helfen. Während in „Sex and the City“ noch eine gesamte Folge davon handelte, dass Miranda trotz ihres androgynen und burschikosen Auftretens nicht lesbisch ist, weil Frauen mit kurzen Haaren und einem Hang zu Hosen nicht unbedingt lesbisch sein müssen, ist das in der neuen Serie komplett überworfen.
Werbung
Miranda verliebt sich in die non-binäre Che und betrügt ihren Ehemann. Ein Schritt, den ihre Freundinnen zwar mit ihr diskutieren wollen (so wie früher), doch die Diskussion wird abgeblockt und jeder, der an ihrem plötzlichen Wechsel an Geschlechtspartner und Sexualität zweifelt, als intolerant dargestellt. Che wurde später aus der Serie gestrichen, weil alle wirklich alle diesen Charakter gehasst haben, aber das kann Miranda auch nicht mehr retten.
Chancen, erstmals Themen anzusprechen, die die Zuschauerinnen vielleicht wirklich interessiert hätten, werden entweder nicht genutzt, gehen in dem ganzen Woke-Theater unter oder werden einfach zu billigen Witzen verarbeitet, mit denen die Charaktere bloßgestellt werden. Charlotte kommt in die Menopause. Nun ist das vielleicht kein Thema, über das jede Frau gerne im Fernsehen sehen will, allerdings war Sex and the City schon immer eine Serie, die solche Themen behandelt hat.
Statt das Thema würdevoll zu behandeln, wird Charlotte für ihre anfangs unproblematische Menopause mit öffentlicher Blamage bestraft. Sie bekommt unbemerkt eine „Flash Periode“, trägt natürlich ausgerechnet an dem Tag eine schneeweiße Latzhose und rennt mit blutverschmiertem Hintern durch New York, bis ihre Freundinnen sie retten.
Ausgerechnet die Sendung, die früher einmal gezeigt hat, dass Frauen über 30 Jahre 1. noch nicht tot umfallen müssen und 2. sich auf ihre Weise emanzipieren können, gibt Frauen über 50 Jahren nun zur Notschlachtung und Entwürdigung frei. Zu sehen, was aus „Sex and the City“ in „Just like that“ gemacht wurde, ist ein bisschen wie mitansehen zu müssen, wie ein guter Freund an Alzheimer leidet und sich immer weiter selbst vergisst.
Wenn „And just like that“ eines beweist, dann wie feministisch „Sex and the City“ wirklich war und auch heute noch ist. Sie stellte wirklich noch Frauen in den Mittelpunkt. Frauen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. In „And just like that“ müssen ihre Wünsche den Bedürfnissen der anderen weichen. Frauen müssen sich selbst zensieren, bis nichts mehr von ihnen übrig ist, und sind ansonsten nur noch Witzfiguren, deren eigene Probleme nicht interessieren. Wenn das Feminismus ist, dann will ich ihn wirklich nicht.

 Freund werden
Freund werden


 Freund von Apollo News werden
Freund von Apollo News werden 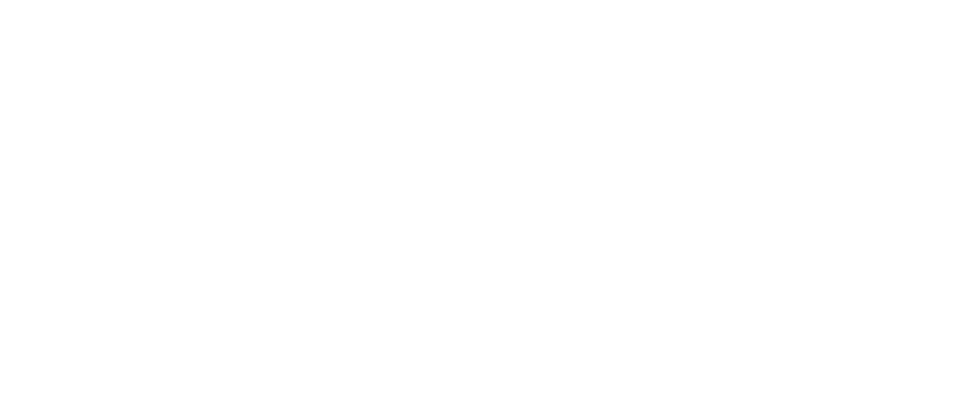
Vielen Dank für diese wie immer kluge und vergnügliche Analyse! J.K. Rowling würde Elisa „Carrie“ David lesen 😉 Wir alle sowieso!
Kann mich noch erinnern, wie die Serie 1998 angelaufen ist. Ich habe sie – wie fast alle Männer – eher gehasst. Es war so der Typ Serie, wo man von der Freundin verdonnert wurde, das mitzugucken.
Und trotzdem habe ich eben als erstes gedacht: Mein Gott, wie normal 1998 noch alles war.
Irgendeine Kollegin hatte mir, damals, als die Serie lief, mal gesagt:
„Sex and the City“, das ist nur für Frauen.
Sicherlich hatte die recht.
Aber es hat Spaß gemacht, zu lesen wie Frau David darüber schreibt.
Es ist Two und a Half Mann für Frauen.😆 Für Männer ist das nicht so interessant deshalb war die Serie aber erfolgreich bei den Frauen es ging halt um Frauen Themen.
Hab‘ ich nie gesehen – war immer ein Desperate Housewives Fan 😊. Ich hoffe doch sehr, dass das nicht auch noch fortgesetzt wird.
Feminismus war schon immer schädlich, wie all die anderen -ismus -Ideologien! Sie alle haben mit Individuen nichts im Sinn, sondern wollen Menschen bevormunden und abrichten.
Und vor allem: Sie spielen für den naiven und gutgläubigen Normalbürger die Rolle des unterstützungswürdigen (wenn nicht gar moralisch gesehen „unterstützungspflichtigen“) Kämpfers für Gleichberechtigung, während das tatsächliche Endziel die Überberechtigung ist.
Ähnlich wie im Kommunismus, wo die vorherige (häufig tatsächliche) Geringschätzung des Proletariats als Berechtigung zu dessen kommender Diktatur abgeleitet wird, zumindest in der Theorie. Oder beim „Antirassismus“, der nahezu immer die Diskriminierung von Weißen fördert.
Ich versteh das Problem nie richtig.
„Weisse“ machen halt Filme, Kosmetik, Mode, … für sich.
Wenn das anderen nicht gefällt, warum gucken/kaufen sie es dann und produzieren nicht selber was?
Ich finde nach wie vor faszinierend, dass diese Serie überhaupt Fans in Europa gefunden hat. Für die prüden Amis verstehe ich das, dass das damals weltbewegend war, wenn in einer Serie offen über Sex gesprochen wird. Aber hier in Europa? Da kam mir das alles totlangweilig vor.
Hab schon das Original nicht gesehen, warum sollte ich den woken Abklatsch sehen wollen. Bin weiß, hetero und empfinde „Politische Korrektheit“ einfach nur ein aufgezwungenes Konstruckt. So schauts aus.
Ich habe versucht diese Serie anzusehen und ich habe noch nicht einmal die Erste Folge geschafft weil ich keine Frau bin. Deshalb habe ich wohl er die Serie mit Charlie Harper geschaut. Aber auch nur bis Charlie Sheen gegangen ist dann war auch das nicht mehr die selbe Serie. Ich habe mich schon sehr lange vom TV verabschiedet weil es wirklich immer schlechter wird und niemand mehr diesen ganzen Woke Müll gucken kann. Es gibt ja zum Glück noch Videos die man sich ansehen kann, alle alten Serien gibt es auf DVD. Aber in der heutigen Zeit ist es doch eher Tik Tok das die Leute anzieht.
Die Woken machen vor nichts halt.
Und richten alles zugrunde.
In den 90’ern hat irgendwie jeder jeden akzeptiert und auf eine gewisse Art sogar gemocht, unabhängig von den eigenen persönlichen Überzeugungen. Heute wird jeder von „weltoffenen“ Linken gehasst, der nicht im Gleichschritt mit den eigenen persönlichen Überzeugungen läuft. Das sieht man an dieser Serie aus den 90’ern und ihrer woken Neuauflage sehr gut.
„Samantha will Sex haben wie ein Mann“ Das ist etwas ungenau. Wie welcher Mann denn? Aus den 20%, um die sich alle Frauen schlagen, oder den anderen 80%? In letzterem Fall ginge Sex dann gegen 0…
Ich finde weiße Serien geil. Alles was gegewärtig aufgefahren wird und mit Indern und Arabaern durchseucht ist, nervt und punktet bei mir nicht ein bisschen. Aufgewachsen ohne Migrationshintergrund und das war verdammt sexy. Seit 1990 ist das leider komplett vorbei.
Und Sex and the City, nun gut, will man wirklich Frauen sehen, die zur besten Serienzeit schon altersmäßig recht grenzwertig waren und heute nochmal 20 Jahre älter sind? Da ist uns etwas erspart geblieben und damit meine ich gesichert nicht die Diversität.^^
Wann wird z.B. endlich mal eine Serie gedreht über das Leben eines Übeltäters, welcher zufällig, beim Spaziergang, an einem Standesamt vorbei kommt, reingeht und sein Geschlecht von Mann auf Frau zurecht drehen läßt. Nach dem Urteilsspruch „Im Namen des (wessen) Volkes“ Einweisung in den Frauenknast. Dort werden die Folgen 2 bis 7 gedreht mit all den Problemen, die sich so ergeben wenn ein Schniedelwutz auf viele weibliche „Entsprechungen“ trifft.
Erinnert mich an ein Rheinwiesen-Lager für Frauen im Mai 1945. Wehrmachtshelferinnen schmuggelten einen jungen Soldaten der Luftwaffe in ihr Lager und teilten mit ihm nicht nur die Verpflegung. Der junge Soldat mußte so oft ran daß er danach längere Zeit von Frauen und Sex die Nase gründlich voll hatte. So eine Serie muß heutzutage unbedingt CO²-arm gedreht werden, unter Verwendung von Lastenfahrrädern sowie total veganer Verpflegung am Set. Kann der RRB nicht so was machen? Natürlich mit Anna Wollmer als Drehbuch-Schreiberin!