»Du sagst: „Der deutsche Schäferhund hat ein braunes Fell.“ Und der Zuschauer macht: „OH!“ Warum? Weil sein Hirn verstopft ist. Zugemüllt mit schlechten Comedy-Sendungen, in denen der Begriff „Braun“ der Gipfel dessen ist, was irgendeinem Autor zum Thema drittes Reich eingefallen ist.«
Harald Schmidt hat mit diesen Sätzen eigentlich schon vor vielen Jahren alles gesagt, was man zur sogenannten Debatte um die Affäre Aiwanger wissen muss. Braun – OH! Das ist der Gipfel dessen, was dem veröffentlichten Durchschnitt zum Nationalsozialismus einfällt. Aiwanger – Böse!
Wie hohl das deutsche Gedenken an die NS-Verbrechen längst geworden ist, offenbarte jüngst Florian von Brunn – das ist der Mann, der für die SPD bayerischer Ministerpräsident werden will. Auf dem Gillamoos, einer Art politischem Volksfest, will der Kandidat dem Hubert Aiwanger so richtig einen mitgeben und sagt den Satz: „Sophie Scholl hatte Flugblätter gegen die Nazis verteilt und wurde dafür hingerichtet. Und Hubert Aiwanger hatte in seiner Tasche Flugblätter in denen tapfere Frauen wie Sophie Scholl verhöhnt wurden“, ruft von Brunn in ein Sozen-Bierzelt hinein.
Der aufmerksame Zuhörer wird sich fragen: Was hat Sophie Scholl damit zu tun? Die 22-Jährige Studentin wurde 1943 von den Nazis hingerichtet, weil sie Flugblätter gegen Hitler verteilt hatte. 80 Jahre später wirft ein blasser Politiker ihren Namen durch einen Raum voll mit Bierdunst und angetrunkenen Genossen, um einen Punkt im Polit-Gehaue gegen Aiwanger zu erzielen. Warum? Weil sie auch Flugblätter verteilte, wie angeblich Aiwanger? Sophie Scholl starb auch nicht im KZ. Offensichtlich hat von Brunn überhaupt keine Ahnung vom Schicksal der Scholl-Geschwister. Er wollte nur irgendwas gesagt haben – irgendwas gegen Aiwanger und mit Nazi-Bezug. Da passte Sophie Scholl gerade recht.
Deutschlands Erinnerungskultur karikiert die Nazis – echte Auseinandersetzung findet nicht statt
An der Causa Aiwanger habe die deutsche Erinnerungskultur „Schaden genommen“, meinen viele. Ja, das hat sie. Aiwanger habe diese torpediert, sagt Felix Klein, Antisemitsmusbeauftragter der Bundesregierung. Aber gibt es da denn noch viel zu torpedieren?
Von Brunn ist nur der Gipfel der Gedankenlosigkeit in einem politischen Skandal, der mal wieder offenbart, wie wenig Substanz das deutsche Gerede über die eigene „Erinnerungskultur“ wirklich hat. Wenn der Chef der KZ-Gedenkstätte Dachau einen öffentlichen Besuch von Hubert Aiwanger jetzt ablehnt, wie Felix Klein ihn vorgeschlagen hat, dann ist es einer der wenigen Lichtblicke. Eine Art Wallfahrt vor Kameras zu einem Konzentrationslager wäre genau die falsche Reaktion auf diesen Skandal: Als wäre Dachau eine Kathedrale, in der Sünder Abbitte leisten können. Das ist alles, was viele in den alten Konzentrationslagern noch sehen: Einen Ort der eigenen Reinwaschung. Das Ticket zum Betreten der Gedenkstätte wie ein Ablassbrief.
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus findet nicht mehr statt: Die Frage, was die Ideologie der Nazis ausmachte und vor allem, wie sie Deutschland übernehmen konnte. Ja, irgendwas mit Weimar und dann war der Hitler da. Als sei der Führer als das fleischgewordene Böse direkt aus der Hölle in die Reichskanzlei heraufgefahren. Was dieses Böse ausmacht – egal. Dass es eben das Banale, das Menschliche ist, was den NS gefährlich und eben auch erfolgreich machte, wie Hannah Arendt sagte, darüber wird gar nicht mehr gegrübelt. Ihr Bericht über Holocaust-Organisator Adolf Eichmann vor Gericht zeichnete das Bild eines Mannes, der von Ton und Auftreten her auch Sachbearbeiter in einer KFZ-Stelle oder beim Bürgeramt sein könnte – und keinen cartoonhaften Bösewicht, bei dem der Hass und das Höllische aus jeder Pore trieft.
Um das zu Begreifen, müsste die Auseinandersetzung mit zwölf Jahren Hitler-Herrschaft mehr sein als nur der Besuch einer KZ-Gedenkstätte und das mantraartige Feststellen, dass Hitler das böseste in der Geschichte des Bösen sei und seine Taten das schlimmste Verbrechen in der Geschichte der Verbrechen – mindestens. Dabei ist die Frage im Zentrum doch, wie es soweit kommen konnte. Wie eine Gesellschaft in den entgrenzten Hass auf eine Minderheit abgleiten kann.
Und eigentlich wäre die Frage rund um das Flugblatt vom Aiwanger-Bruder sehr interessant für solche Gedanken. Natürlich wird aus den widerwärtigen Zeilen keine ernsthafte nationalsozialistische Gesinnung deutlich. Aber warum will ein Pubertärer ausgerechnet mit Auschwitz provozieren? Woher kommt das Faszinosum Hitler, das ja so viele in diesem Alter haben. Warum imitiert man den Führer in seiner markanten Redeweise so häufig an deutschen Schulen? Das sind sicher nicht bloß verkappte Faschisten – aber was ist es? Was an unserer Erinnerungskultur produziert das? Ist das unvermeidbar? Was bedeutet es für uns als Gesellschaft? Eigentlich sollte man darüber nachdenken, tief nachdenken. Stattdessen drischt man hohl auf Hubert Aiwanger ein, nach 36 Jahren. Es geht längst sowieso um den Wahlkampf.
Die Selbstbeweihräucherung des „Tätervolks“
Aber damit man nicht nachdenken muss, gibt es ja eben die neue deutsche „Erinnerungskultur“. Sie ist Kreation einer Gesellschaft, die mit ihrer Vergangenheit längst Frieden geschlossen und den Holocaust mit Hilfe der „Wiedergutmachung“ zu ihrem Unique Selling Point umgedeutet hat. So formuliert es der Publizist Henryk M. Broder, Sohn einer Auschwitz-Überlebenden. Recht hat er: „Erinnerungskultur“ ist schon seit Jahren nicht viel mehr als eine Selbstbeweihräucherung. Wenn deutsche Politiker heute sagen, dass es „kein Deutschland ohne Auschwitz“ gäbe, meinen sie das nicht mit Scham – es ist kaum verhohlener Stolz, der aus diesen Worten dringt. Stolz darauf, wie toll man mit der eigenen Vergangenheit umgeht. Er kommt dann zum Vorschein, wenn sie die Israelis belehren, dass „gerade sie“ es ja besser wissen müssten, als die Palästinenser zu diskriminieren. Wenn sie den Amerikanern, ohne die Dachau noch heute in Betrieb wäre, großkotzig erklären, wie sie mit ihrer eigenen Vergangenheit umzugehen hätten. Moderner deutscher Nationalismus und Chauvinismus existieren nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Die Deutschen sind Erinnerungsweltmeister – und haben sich vor dem Altar der KZ-Gedenkstätten selbst die Absolution erteilt.
Ab und an kann man das dann auch mal für politische Schmutzkampagnen nutzen. Freilich nur ausgewählte Politiker. Dass die SPD-Jugend mit der Palästinenserorganisation Fatah zusammenarbeitet, deren Chef einen akademischen Abschluss in Holocaustleugnung gemacht hat und das Verbrechen relativiert; die den israelischen Staat und damit auch all seine jüdischen Bewohner „ins Meer treiben“ und vernichten will, ist egal. Dass ehemalige deutsche Außenminister diesen Mann als einen guten Freund betiteln können, ist egal. Nur der Aiwanger, der ein Flugblatt mit KZ-Bezug in der Tasche hatte – der ist derjenige, der die Erinnerungskultur beschädigt, untergräbt, torpediert.
Die Affäre Aiwanger zeigt auch, dass sich zunehmend die DDR-Strategie einer Erinnerungskultur verfestigt: Das Gedenken als politisches Instrument – und die Einbettung der Geschehnisse ins ideologische Weltbild. Nach dem Krieg wollte man im Osten echtes Nachdenken über die Geschehnisse oder gar Schuldgefühle ganz bewusst verhindern, um das Volk ohne großes Umdenken vom Nationalsozialismus in den Sozialismus reibungslos zu überführen. Schuld waren dann eben die paar Großkapitalisten und Propagandisten. Eigentlich war die bundesrepublikanische Form der Erinnerungskultur eine andere: Sie sollte das Nachdenken in den Mittelpunkt stellen. Das Hinterfragen. Das Grübeln.
Wir sind beim Gegenteil angekommen. Bitte nicht nachdenken. Lieber Parolen rufen. Sich selbst am eigenen Gutsein berauschen.
Aiwanger – OH! Böse. Nazi.
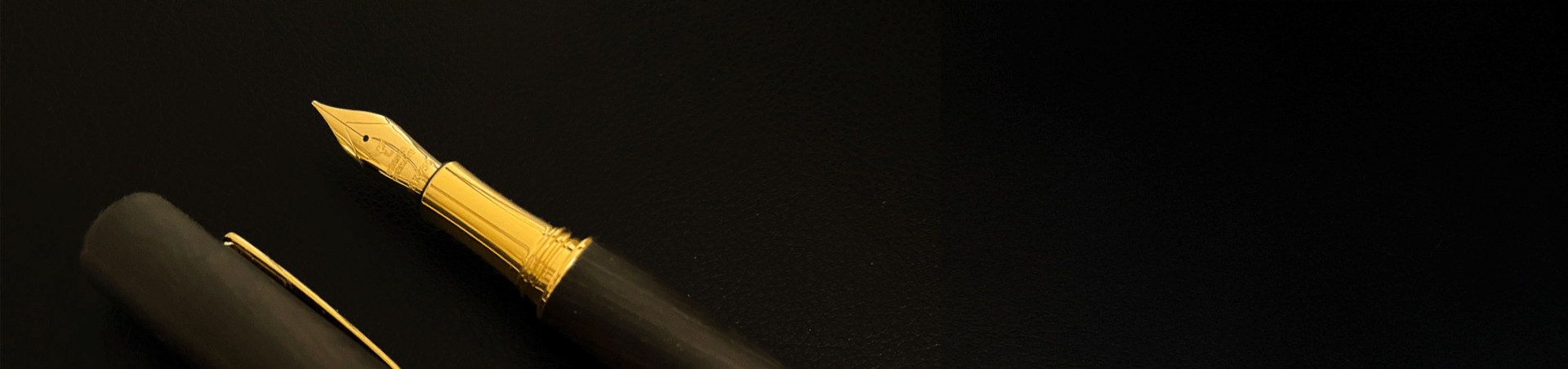
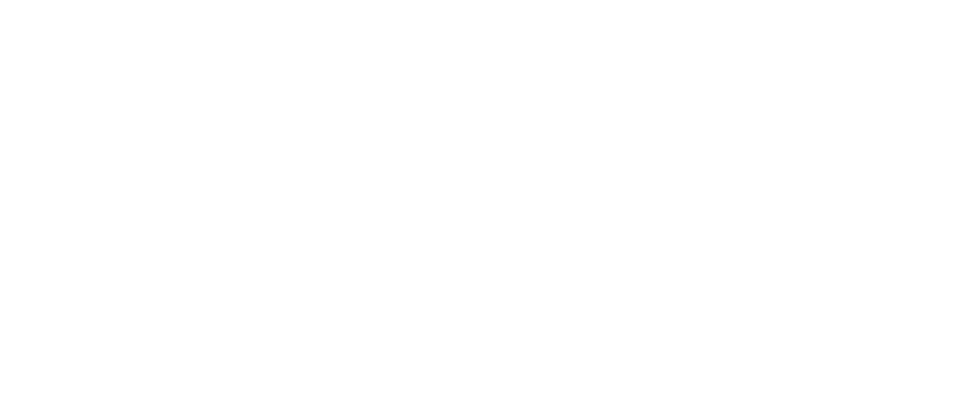
Für mich als einen Beobachter aus dem (zwar nahen, aber immer noch) Außland kommen die auf der Apollo-Seite bisher erschienenen Reaktionen als leicht naiv vor. Aiwanger hatte gegen mehrere Artikel der Vergangenheitsbewältigungsreligion verstoßen, die Gutmenschen haben reflexmäßig ihre seit langem bestens bekannte ritualisierte Bestürzung vorgeführt, also los, nimmt man Aiwanger in Schutz. Oder, bestenfalls, wie in diesem Beitrag, entlarvt man wieder schon bei ähnlichen früheren Gelegenheiten die tausendmal entlarvte Heuchelei dieser Rituale. Alles so vorhersagbar, der pawlowsche Hund lässt grüßen.
Dabei scheint man, vergessen zu haben, welche Rolle wurde vor der Flugblatt-Affäre eigentlich HA und der FW in der bayerischen, und aussichtsweise vielleicht auch bundesdeutschen, Politik vorgesehen. Er sollte doch eine „anständige“ und salonfähige rechtskonservative Wählerschaft binden, die rechte Flanke der CSU decken und dabei die AfD kleinhalten. Dieser Spaltpilz-Rolle war HA selbst perfekt bewußt, äußerte auch mehrmals ganz offen dazu, und genoß als Gegenleistung eine verhältnismäßig milde (im vergleich zur AfD, versteht sich) Behandlung durch die Lügenpresse. Und alles ging gut voran: Söder war Ministerpräsident, Aiwanger machte seine begrenzte Karriere und die linken Strategen freuten sich, weil das seit jeher als Papiertiger und Scheinopposition bewährte FW-Irrlicht, im Gegenteil zur AfD, keine richtige Gefahr für die Bunte Republik darstellte.
Und nun dieses verdammte Flugblatt, dessentwegen mußte sich der heilige Kampf gegen Rechts in den eigenen Schwanz beißen, so eine Panne! Den „bösen Nazi“ Aiwanger nicht zu beurteilen würde bedeuten, bei eigenen idealistischen Anhängern Glaubwürdigkeit zu verlieren. Andererseits, HA kann man natürlich zerschlagen und auf den politischen Müllhaufen werfen, aber die konservative bayerische Wählerschaft wird immer noch da sein, d.h. erneut eine AfD-Verstärkung riskieren? Auch schlecht. Das einzige Hoffnung jetzt wäre, die öffentlichen Antinazi-Tänzchen noch eine Zeitlang zu wiederholen und gleichzeitig überlassen es dem Bierzelt, ihren Hübsi vor der Wahl noch zu reanimieren und zurück auf die Bühne zu schicken. Das kann wohl ganz gut gelingen: erinnert man noch auf die „Unsere Rache-wähl Strache“-Episode?
Ein weiterer recht spannende Aspekt dieser Affäre ist natürlich der geheimdienstliche (die übliche QUI BONO-Frage), aber da braucht man eine ausführlichere Überlegung, samt zusätzliche Sachkenntnisse.
Phantastisch. Was für ein gewaltiger Unterschied: Diese hervorragende Analyse mit Ausflügen in die Psychoanalyse, geschrieben von einem Anfangszwanziger, und das dümmliche, substanzlose und von jeder Kenntnis über deutsche Geschichte befreite Gelaber von (meist, aber nicht ausschließlich linksbeseelten) Losern die sich für maßgeblich und berufen halten, uns die Welt zu erklären.
Die Linken und die Grünen, all diese Gut-, Besser- und Bestmenschen- warum nur kriegen die sich gar nicht mehr ein in der Causa Aiwanger? Allenthalben: rrächts, rrächts, Naazi Geschrei. Mir dünkt, die schreien deshalb so laut, weil ihre eigene Methodik sehr nahe an der der Nationalsozialisten ist. Scheints, das sich Deutschland bis dato von dem Trauma der Ismen des 20. Jahrh. noch nicht lösen konnte.
Dieser Text müsste allen Politikern und Journalisten, die zu den jeweiligen Gedenktagen ihre tiefbetroffenen und selbstzufriedenen Reden halten und ihre Artikel drucken lassen, ins Stammbuch geschrieben werden, versehen mit dem Zusatz: Wer zum Nationalsozialismus und zum Holocaust nichts fühlt: bitte Schnauze halten!
Ich war schon etwas verärgert, weil es keine brauchbare Zeitung mehr gibt und mich die üblichen Artikel ankotzen.
Apollo schreibt aber ganz gut, denkt nach und und wiederholt nicht ständig den gleichen Durchfall, welcher von den Redaktionen gefressen, verdaut und einander wieder hingedurchfallt wird, um ein Karussell des Wahnsinns anzutreiben.
Eine kleine Kritik auf hohem Niveau, weil mich wesentliche Infos immer noch nicht erreichen. Mich würde interessieren, wer jetzt genau was vor 36 Jahren auf ein dem Aiwanger zugerechnetes Druckwerk geschrieben hat.
Florian von Dumm,oder wie der SPD-Fritze heißt,ist ein typisch rotgrüner Hetzer und dieser,wie so viele RotGrüne Hetzer ohne Ahnung..
Was hat das Flugblatt von den damals Minderjährigen Helmut Aiwangers(Verfasser) mit dem Flugblatt der Geschwister Scholl zu tun?
1.) überhaupt nichts,da die Flugblätter der Geschwister Scholl erst verteilt wurden,als der Krieg nach Stalingrad eine deutliche Wendung nahm..
Dieses Flugblatt rief zum Sturz des Hitler-Regimes auf..Von der Rettung der Juden stand in keinem der Flugblätter etwas drin.
2.)der bekannte und renomierte Historiker Prof. Wolfssohn sagte gegenüber der Bildzeitung:
Das Flugblatt des Aiwangers ist absolut übel,aber keineswegs antisemitisch..
3.)Warum wohl? in dem Schmierblatt eines Minderjährigen stand drin,dass man alle Volksverräter in ehemaligen Einrichtungen,wie Dachau usw. unterbingen sollte usw..
Von Juden war in dem Aiwanger -Flugblatt in keiner Zeile die Rede..
Und wenn man von Dachau redet,muss man erwähnen,dass dort nicht nur Juden saßen,sondern auch Regimegegner die keinen jüdischen Glauben hatten.
Also was soll diese Pauschalisierung des SPD-Brüllers..
4.)der Co-Vorsitzende der Grünen Omid Nouripour wurde 2020von dem bekannten „Simon-Wiesenthal-Center“ auf die Lister der
10 schlimmsten Antisemiten weltweit gesetzt.
Die Jungsozialisten der SPD tauchten in der Liste des Simon-Wiesenthal-Centers ebenfalls auf,als schlimme Antisemiten..
Und Lee Heinrich,die Vorsitzende der Grünen Jugend ist für ihren Antisemitismus auch bekannt,den Sie stets offen ausgetragen hat…
Und Sawsan Chebli war früher auch eine Judenfeindin und fürchterliche Antisemitin..Heute gibt diese Chebli sich als angebliche Freundin der Juden aus….was aber nicht glaubhaft ist..Sie will sich allenfalls öffentlich reinwaschen,um weiter im Zirkus der Gutmenschen mitspielen zu können…
Fazit:Was für eine Doppelmoral,dieser rotgrünen Hetzer..
Die Bürger haben von diesem rotgrünem Mistkübel die Schnauze voll,was ja auch jüngsten Umfragen in Bayern vollends bestätigen
Ob jetzt der Herr Aiwanger ein Holocaust verhöhnendes Flugblatt im Schulranzen hatte oder nicht, die Werbung für die freien Wähler ist unbezahlbar. Heute sah ich gleich ein neues Plakat mit einer Quotenfrau der freien Wähler, und dass soll mir wahrscheinlich das Gefühl geben, ich lebe in der besten Demokratie auf deutschem Boden. Mein Vater war nur Kriegsheimkehrer aus der ehemaligen Sowjetunion, in den siebziger Jahren las er Alexander Solschenyzins „Der Archipel Gulag“. Da wir heute so viele ideologisch Verblende haben (Frankfurter Schule) ist heute über die Massenmorde in Nordkorea, Nordvietnam, Kambodscha China, Sowjetunion so gut wie nichts bekannt. Der Herr Trittin zum Beispiel vertrat als Mitglied einer maoistischen Vereinigung, die seine Karriere als Politiker überhaupt erst begründete, einst über Jahrzehnte radikal-feindliche Hass-Einlassungen gegen die Bundesrepublik. Herr Trittin versenkte demonstrativ ein Exemplar des Grundgesetzes in der Weser, besetzte aktiv und über Jahre in linksradikaler Attitüde Häuser, und wollte sich für menschenverachtendes Hohngelächter über Mordopfer der RAF einer Göttinger Zeitung, für die er mit verantwortlich war (Mescalero) nicht entschuldigen, was er dann entscheidend viel später nachholte. Als grüner Funktionsträger half er ein kinderverachtendes pädophiles Parteiprogramm durchzusetzen.
Ja Herr Roland, Sie haben recht: Es geht den selbsternannten Kämpfern gegen rechts nicht darum, aus der Geschichte zu lernen, sondern sie benutzen diese nur als Waffe gegen ihre Kritiker. Insofern machen sie sich also der von ihr andauernd angeprangerten Instrumentalisierung schuldig.
Echte Erinnerungskultur würde doch bedeuten, sich selbst auf dem Hintergrund der Geschichte kritisch zu hinterfragen. Nichts aber liegt ihnen ferner.
Guter Artikel.
Die Methode „von Brunn“ ist abstoßend und darauf gerichtet, mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte maximal Aufmerksamkeit zu generieren. Sonst nichts!
Vielen Dank für den wirklich guten Artikel.
Die SPD unter ihrem blassen Spitzenkandidaten von Brunn kommt auf schlappe neun Prozent und verliert am stärksten laut der neuesten Umfrage. Ich sehe mittlerweile einen Zusammenhang zwischen dem Lehrer i.R., Franz Graf, der mit Ihm bestens bekannten SPD-Generalsekretärin Ruth Müller aus Landshut und dem Auftritt eines polternden Scholz auf dem Marienplatz. Exakt eine Woche später macht die Süddeutsche Zeitung mit Aiwangers Flugblatt auf. In meinen Augen ein SPD-gesteuerter Aktionismus, um die Kanzlerpartei über die 9% mindestens in den zweistelligen Bereich zu heben! Es gibt keinen Zufall!
Hitler wurde selbstverständlich auch von SPD- und KPD-Anhängern gewählt. Dies zu benennen, wäre von einem Mann wie Herrn von Brunn wohl zu viel verlangt.
Danke für Ihren Beitrag. Es wird auch häufig ignoriert, dass viel Sozialismus drinsteckte. Die handelnden Personen kamen ja auch teils von linken Parteien.
Dass es wirkt, was Sie oben beschreiben, sieht man in München: das Bärtchen dürfte auf jedem Aiwanger Plakat sein wie auch die FCKNZS (wenn ich das recht gelesen habe) usw..
Dass man jemanden wie Herrn Aiwanger, der beliebter wurde, weil es Wahrheiten offen genannt hat, nicht gewähren lassen konnte, war eigentlich klar. Die Sache setzt ja eine Serie fort, die irgendwo bei Herrn von Guttenberg medial startete. Vorher wurden bereits viele zur EU abgeschoben (oftmals aber, weil sie in den jeweiligen Ländern nicht mehr tragbar waren). Aktuell Herr Aiwanger und Herr Maaßen und kurz vorher Herr Sarrazin und Herr Palmer. Sicher gibt es noch viele Namen, teile prominent, teils weniger.
Da macht es Hoffnung auf die neuste Umfrage von Insa zu sehen: FW bei 15%. Man könnte die Aktion als Eigentor bezeichnen.
Und sehr schade, dass viele die positiven Aussagen zum Thema Flugblatt und Herr Aiwanger (und es geht nur um Aussagen, nicht um Fakten) schlichtweg ignorieren und nur alles akzeptieren, was gegen Herrn Aiwanger spricht.